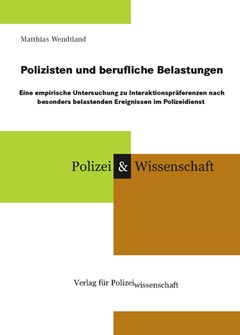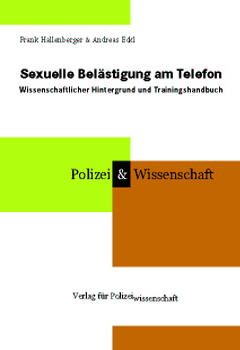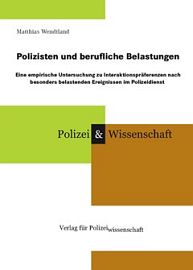
Nordrhein-Westfalen von außergewöhnlichen Situationen ihres Berufes,
die sie spürbar belastet haben. Die Auswertung der Interviews konzentriert
sich vor allem auf die Frage, mit welchen Personen anschließend über
diese Erlebnisse gesprochen werden konnte. Während einige Polizisten
diese Erfahrungen grundsätzlich mit niemandem teilen, wählen andere
gezielt Kollegen oder Ansprechpartner aus ihrem privaten Umfeld aus. Etliche
Beamte sprechen mit mehreren Personen aus unterschiedlichen Interaktionsfeldern
über ihre Erlebnisse.
Neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse verfolgt die Studie auch
das Ziel, durch die spannenden biographischen Geschichten Berufspraktikern
einen überblick über mögliche berufliche Belastungsszenarien
zu geben, um zu überlegen, wie man selbst in vergleichbaren Situationen
handeln würde und wer anschließend als Ansprechpartner in Frage
käme.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
1.1 Belastungen im Polizeidienst aus der wissenschaftlichen Perspektive
1.1.1 Begriffsdefinitionen
1.1.2 Erkenntnisse zu Belastungen im Polizeidienst
1.1.3 Stressbewältigungs- und Verhaltenstrainings bei der Polizei in
Nordrhein-Westfalen
1.1.4 Umgang mit posttraumatischen Belastungsstörungen bei der Polizei
in Nordrhein-Westfalen
1.1.5 Berufssoziologische Perspektive
1.2 Methode
1.2.1 Ziel der Untersuchung
1.2.2 Angewandte Untersuchungsmethoden
1.3 Durchführung der Untersuchung
2. Interviewauswertungsergebnisse
2.1 Typologieentwicklung
2.1.1 Interaktionspartner im überblick
2.1.2 Konstruktion der Typologie 54
2.2 Vorstellung der Typen 58
2.2.1 Allein
2.2.2 Partner 108
2.2.3 Kollegen 130
2.2.4 Besondere Interaktionspartner 166
2.2.5 Plural angelegte Interaktionsstruktur 217
2.3 Grundsatzüberlegungen zum Interviewmaterial
2.3.1 Nicht erreichte Polizeibeamte
2.3.2 Auswirkungen auf die Konstruktion der Typologie
2.3.3 Sättigung des Samples
2.3.4 Zusammenfassender überblick über nicht ausgewertete Interviews
2.4 Vergleich der Typen
2.4.1 Gemeinsamkeiten
2.4.2 Prüfung der weiterführenden überlegungen
2.4.3 Zwischenfazit
2.4.4 Unterschiede
2.4.5 Wanderbewegungen
3. Zusammenfassung
3.1 Belastungen aus der Sicht von Polizeibeamten
3.2 Wahl der Interaktionspartner
3.3 Belastungen im Zusammenhang mit innerdienstlichen Problemen
3.4 Bewältigungshilfen
4. Empfehlungen
4.1 Trainingsinhalte
4.2 Adressaten
5. Eigene Stellungnahme
Literaturverzeichnis
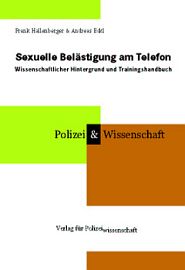
In diesem Buch wird zum Einen die wissenschaftliche Fundierung dargestellt,
die es ermöglicht, eine psychologische Intervention bei sexueller Belästigung
zu erarbeiten. Der soziale Akt des Telefonierens und das Phänomen sexuelle
Belästigung werden definiert und in einen Zusammenhang mit vorliegenden
theoretischen und empirischen Erkenntnissen der modernen Psychologie gebracht
werden. Im zweiten Teil des Buchs wird ein expliziertes Manual zur konkreten
Umsetzung der interventorischen und präventorischen Manahmen dargestellt.
Inhalt
I. GRUNDLAGEN
1. Psychologie der sexuellen Telefonbelästigung
1.1. Das Telefonieren als zwischenmenschliches Phänomen
1.2. Definition der sexuellen Telefonbelästigung
1.3. Zeitgeist, Telefonsexkultur und Telefonterror: ein soziologischer Exkurs.
1.4. Telefonbelästigungen aus kommunikationspsychologischer Sicht
2. Empirische Untersuchungen zu sexuellen Belästigungen am Telefon
2.1. Resümee zu den Untersuchungen aus dem angloamerikanischen Raum
2.1.1. Prävalenzen und Formen sexueller Belästigungen am Telefon
2.2. Resümee über bisherige Untersuchungen aus dem deutschen Sprachraum
3. Gefährlichkeit und Motivation der Belästiger
4. Die rechtliche Lage in Deutschland und im Ausland
5. Entwicklung eines Interventionsprogramms zum Umgang mit sexuellen Belästigungen
am Telefon
5.1. Ziele und Struktur der Interventions- und Präventionsmaßnahmen
bei sexuellen Belästigungen am Telefon
5.2. Form und Durchführung des Trainingsprogramms
5.3. Psychologische Konstrukte und Hintergründe zu den einzelnen Interventionsmaßnahmen
6. Hinweise zur Evaluation
II. PRAKTISCHES TRAININGSHANDBUCH
BAUSTEIN 1 Kategorie A:
Information
BAUSTEIN 2 Kategorie A:
Analyse
BAUSTEIN 3 Kategorie A:
Information
BAUSTEIN 4 Kategorie B:
Verarbeitungsmodifikation
BAUSTEIN 5 Kategorie B:
Verarbeitungsmodifikation
BAUSTEIN 6 Kategorie B:
Verarbeitungsmodifikation
BAUSTEIN 7 Kategorie C:
Verhaltensmodifikation
BAUSTEIN 8 Kategorie C:
Verhaltensmodifikation
BAUSTEIN 9 Einstellungsmodifikation
III. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
LITERATUR
ANHANG