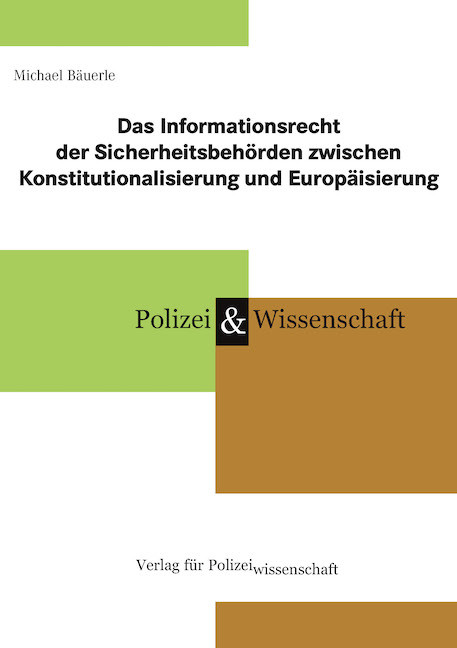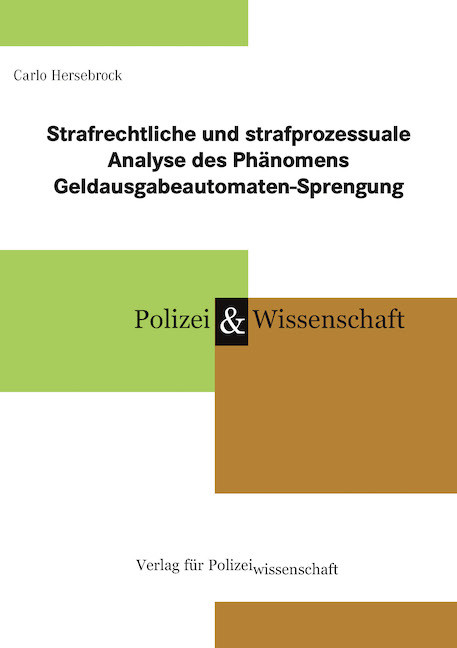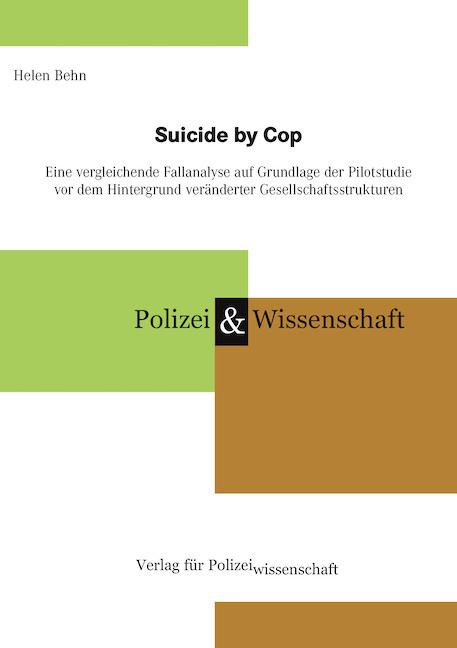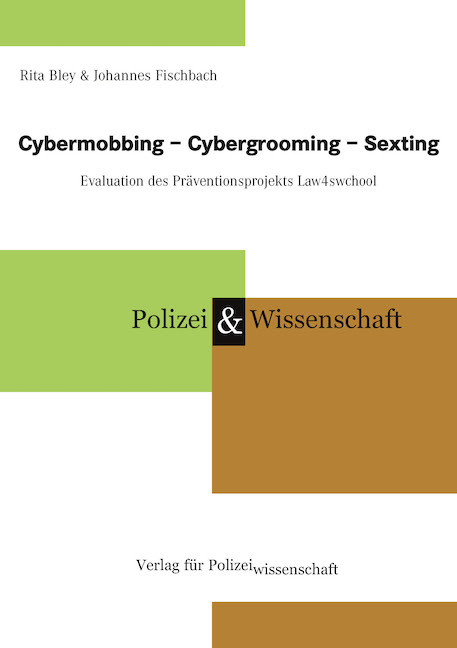Anna Christina Ettmann
Die Konstituierung und Sanktionierung von Kinderpornografie als kriminelle Handlung im justiziellen Diskurs Eine Kritische Diskursanalyse von Strafprozessakten
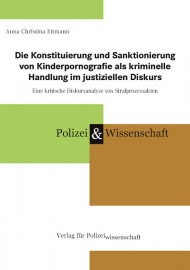
Ausgehend von einem konstruktivistischen Verständnis sozialer Wirklichkeit untersucht diese Forschungsarbeit wie sich Kinderpornografie als kriminelle Handlung im justiziellen Diskurs konstituiert, wie sich das Kinderpornografie-Dispositiv in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert hat und wie sich diese Veränderung in der Sanktionierungspraxis widerspiegelt. Hierzu wurden Kinderpornografie-Strafprozessakten der Staatsanwaltschaft Köln aus den Zeiträumen 2007–2008 und 2015–2022 mit dem Instrument der Kritischen Diskursanalyse ausgewertet.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung und Problemaufriss
1.1 Gesellschaftliche Relevanz der Thematik
1.2 Kinderpornografie in der Forschung
1.3 Zielsetzung, Methodik und Begriffsbestimmung
1.4 Aufbau der Arbeit
Theoretische Verortung
2 Konstituierung von Kinderpornografie
2.1 Konstruktivistischer Ansatz
2.2 Diskurstheoretischer Ansatz
3 Konstruktion von Schuld
3.1 Narrativ der individuellen Schuld im deutschen Strafrecht
3.2 Konstruktion individueller Schuld in Strafprozessen
4 Sanktionierung von Kinderpornografie
4.1 Formelle Sanktionierung von Kinderpornografie-Delikten im Wandel der Zeit
4.2 Informelle Sanktionierung von Kinderpornografie-Delikten im Wandel der Zeit
4.3 Funktionen von Strafe aus soziologischer Sicht
Empirische Untersuchung
5 Diskursanalyse als methodologischer Rahmen
5.1 Kritische Diskursanalyse
5.2 Instrumente zur Rekonstruktion des Kinderpornografie-Diskurses
6 Strafprozessakten als Untersuchungsgegenstand
6.1 Aufbau, Inhalt und Bedeutung von Strafprozessakten
6.2 Auswahl, Beschreibung und Reduzierung des Materialkorpus
6.3 Analyseaufbau und Datencodierung
7 Strukturanalyse
7.1 Formale Analyse der Diskursfragmente
7.2 Rekonstruktion des justiziellen Wissens über Kinderpornografie
8 Feinanalyse
8.1 Falldarstellung
8.2 Rekonstruktion der individuellen Schuldzuschreibung von Kinderpornografie-Tätern
9 Zusammenfassende Diskursanalyse
10 Diskussion
10.1 Wie beeinflussen bestimmte Akteure den Kinderpornografie-Diskurs?
10.2 Trägt der Täter die alleinige Schuld für sein Handeln?
10.3 Wie ist die Schwere der Schuld des Täters zu bewerten?
10.4 Sind Strafen ein geeignetes Mittel, um Kinderpornografie-Delikte zu verhindern?
10.5 Wie können Kinder vor Kinderpornografie-Delikten geschützt werden?
11 Fazit
Literaturverzeichnis
Michael Asche, Luise Greuel & Trygve Ben Holland (Hrsg.)
Liber Amicorum Beinahe eine Festschrift für Arthur Hartmann

Die Fachbeiträge adressieren daher Themen wie Geldwäsche, Opferschutz und Opferrechte, Hate Crime sowie das Polizeirecht, doch auch ethisch-moralische Auseinandersetzungen und geschichtliche Aspekte, die insgesamt der Kriminologie zuzuordnen sind.
Inhalt
Inhalt:
Michael Adelmund & Markus Conrad
Moderne Strategien zur Manipulation von politischer Meinungsbildung auf Social-Media-Plattformen: Wie es der Partei „Die Heimat” (ehemals: NPD) gelingt, Einfluss auf Menschen zu nehmen.
Vasiliki Artinopoulou
Strengthening the rights of the child victims in Greece: the impact of the EU Directive 2012/29/EU
Michael Asche
Nachhaltigkeitsberichterstattung und Bilanzstrafrecht – Kein konfliktfreies Verhältnis, dargestellt am Beispiel von Aufsichtsratsmitgliedern
Frank Czerner
Beatifikation und Kanonisation als „sakrale Konstruktion theologischer Wirklichkeit“ und als römisch-katholische Äquivalente zum Labeling-Approach-Ansatz der Kriminologie?
Ekke Dahle
Das Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes: Johann Peter Hebel und das Verbrechen – ein Versuch
Luise Greuel
Vernehmung – Glaubhaftigkeitsbegutachtung – Opferschutz
Niklas Hartmann
Die Seele des Tyrannen: Versuch zur vergleichenden Metaphysik
Dieter Hermann
Hate Crime und Kriminalitätsfurcht
Sarah Holland-Kunkel
Von den erschwerenden Leichtigkeiten des Forschens
Dennis Klein
Steuerhinterziehung durch Steuergestaltungen
Clemens Lorei & Kerstin Kocab
Fundamentale Voraussetzungen für und individuelle Einflüsse auf polizeiliche Deeskalation in Alltagseinsätzen
Robert E. Mackay
“What would you have done?” Questions from Bernhardt Schlinck’s The Reader
Gabriela Piontkowski
Der mit dem Fuchs tanzt!
Klaus von Lampe
Das Konzept ‚kriminelle Assoziationen‘ als Schlüssel zur Entwirrung krimineller Strukturen und sozialer Beziehungsgeflechte im Kontext organisierter Kriminalität
Matthias Wehr
Nach der Konsolidierung der Reform – Datenverarbeitungsregelungen im Bremischen Polizeigesetz
Niclas-Frederic Weisser
Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche – Ausgewählte aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Vorfeld der Gefahr sowie der höchstrichterlichen Rechtsprechung dazu. Die kritische Betrachtung der informationellen Vorfeldbefugnisse und deren Verfassungsmäßigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Werkes.
Darüber hinaus werden exemplarische Befugnisse des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen und des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes im Lichte der Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts bewertet. Diese Erkenntnisse bieten wertvolle Impulse für eine tiefere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema.
Das Buch richtet sich sowohl an Lehrende und Praktiker im Bereich der Polizei als auch an Studierende, die ihr Verständnis des Gefahrenabwehrrechts vertiefen möchten. Es ist eine wertvolle Ressource für alle, die sich mit den komplexen Fragestellungen des polizeirechtlichen Gefahrenbegriffs auseinandersetzen.
Inhalt
Inhalt:
A. Einleitung
B. Entwicklungslinien: die Gewährleistung öffentlicher Sicherheit und Ordnung als staatliche Aufgabe
I. Vom Spätmittelalter bis zum 21. Jahrhundert
1. Das Spätmittelalter (ca. 1250 bis 1450)
2. Die Neuzeit (ca. 1450 bis 1650)
3. Die jüngere Neuzeit (ca. 1650 bis 1789)
4. Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR 01.06.1794)
5. Entwicklungen in der Weimarer Republik
6. Parallele Entwicklungen im deutschen Raum
7. Weitere Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg
II. Der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung als Staatsaufgabe
1. Die öffentliche Sicherheit
2. Die öffentliche Ordnung
C. Maßgebliche Determinanten bei der Gefahrenbeurteilung
I. Die Gefahrenbegriffe
1. Der klassische Gefahrenbegriff
2. Der moderne Gefahrenbegriff
3. Aufgabenvarianten
4. Wesentliche Gefahrenarten
II. Bestandteile des Gefahrenbegriffes
1. Gefahr und Schaden
2. Gefahrenprognose
III. Das Gefahrenvorfeld
1. Besondere Bedrohungen durch die organisierte Kriminalität und den internationalen Terrorismus
2. Polizeiliche Befugnisse im Vorfeld der Gefahr
3. Tradierte Eingriffsschwellen im Gefahrenvorfeld
4. Korrekturen des BVerfG
D. Bewertung der Erkenntnisse an ausgewählten Normen des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) und des Gesetzes über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Polizei (Polizeiaufgabengesetz – PAG)
I. Polizeiaufgabengesetz – PAG
1. Art. 11 PAG
2. Art. 11a PAG
II. Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen (PolG NRW)
1. Die sachliche Zuständigkeit aus § 1 PolG NRW
2. Verfassungsmäßigkeit grundrechtsbeschränkender Vorfeldmaßnahmen
E. Fazit
Literaturverzeichnis
Michael Bäuerle
Das Informationsrecht der Sicherheitsbehörden zwischen Konstitutionalisierung und Europäisierung
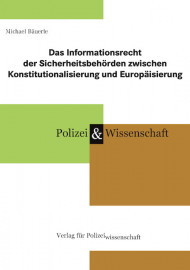
Nachdem das Bundesverfassungsgericht mit dem Volkszählungsurteil klargestellt hatte, dass es sich beim staatlichen Umgang mit personenbezogenen Daten um einen Grundrechtseingriff handelt, wurde das Recht der Sicherheitsbehörden (Polizeien und Nachrichtendienste) in immer stärkerem Maße zu einem Recht des sicherheitsbehördlichen Umgangs mit personenbezogenen Daten und Informationen. Vor dem Hintergrund normativer und faktischer Veränderungen und Umbrüche hat sich dieses Informationsrecht der Sicherheitsbehörden mittlerweile infolge von mehr als zwei Dutzend einschlägigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu einem in hohem Maße verfassungsrechtlich determinierten Regelungsbereich entwickelt. Diese Entwicklung trifft auf eine zunehmende europarechtliche Überwölbung, die ihren Ausgangspunkt in der Zuständigkeit der EU für den Datenschutz nach Art. 16 AEUV fand.
Der vorliegende Band untersucht das sich aus der gleichzeitigen Konstitutionalisierung und Europäisierung des Informationsrechts der Sicherheitsbehörden ergebende Spannungsfeld mit Blick auf die verbleibenden Spielräume des nationalen Gesetzgebers und die aus ihm möglicherweise resultierenden rechtspolitischen Disparitäten oder rechtsdogmatischen Widersprüche.
Inhalt
Inhalt:
A. Problemstellung
I. Hintergrund
II. Erkenntnisziel und Gang der Untersuchung
B. Konstitutionalisierung des Informationsrechts der Sicherheitsbehörden
I. Grundlagen
II. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
III. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
C. Europäisierung des Informationsrechts der Sicherheitsbehörden
I. Harmonisierung im Raum der Freiheit der Sicherheit und des Rechts
II. (Gescheiterte) Teilharmonisierung über die Binnenmarktkompetenz
III. Mittelbare Angleichung über das Erfordernis der Unionsrechtskonformität des Informationsrechts der Sicherheitsbehörden
IV. Unmittelbare Harmonisierung aufgrund der allgemeinen Datenschutzkompetenz (Art. 16 AEUV)
V. Unionsverfassungsrechtliche Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs
VI. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
D. Das europäisierte Informationsrecht der Sicherheitsbehörden zwischen Luxemburg und Karlsruhe
I. „Solange-Rechtsprechung“ des Bundesverfassungsgerichts
II. „Recht-auf-Vergessen-Rechtsprechung“ des Bundesverfassungsgerichts
III. Schlussfolgerungen
E. Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
Anhang
Carlo Hersebrock
Strafrechtliche und strafprozessuale Analyse des Phänomens Geldausgabeautomaten-Sprengung
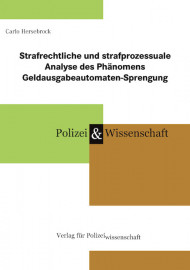
Inhalt
Inhalt:
A. Einleitung
B. Problematik
C. Themeneingrenzung
I. Begrenzung auf niederländische Tätergruppierungen
II. Rechtliche Eingrenzung
D. Methode
E. Polizeiliche Erkenntnisse
I. Struktur des Netzwerks
II. Tatausführende in Deutschland
III. Modus Operandi
IV. Tatziele und Tatzeit
V. Fahrzeuge
VI. Spreng- und Tatmittel zur Herbeiführung der Explosion
VII. Sonstige Tatmittel
VIII. Bekleidung
IX. Typisches Schadensbild/-ausmaß
F. Methodendiskussion
G. Darstellung relevanter Rechtsnormen
I. Strafnormen
1. Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion gem. § 308 I StGB
2. Vorbereitung eines Explosionsverbrechens gem. § 310 I Nr. 2 StGB
3. Schwerer Bandendiebstahl gem. §§ 242 I, 244a I StGB
4. Weitere mögliche Strafnormen im Besonderen Teil
II. Unmittelbares Ansetzen i.S.d. § 22 StGB
III. Verabredung zu einem Verbrechen gem. § 30 II Alt. 3 StGB
IV. Begründung eines Anfangsverdachts gem. § 152 II StPO
H. Rechtliche Analyse des Phänomens GAA- Sprengung
I. Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion gem. § 308 I StGB
II. Vorbereitung eines Explosionsverbrechens gem. § 310 I Nr. 2 StGB
III. Schwerer Bandendiebstahl gem. §§ 242 I, 244a I StGB
IV. Verabredung zu einem Verbrechen gem. § 30 II Alt. 3 StGB
V. Begründung eines Anfangsverdachts gem. § 152 II StPO
VI. Ausblick auf mögliche strafprozessuale Maßnahmen
I. Handreichung zum Umgang mit möglichen Tätern von GAA-Sprengungen
J. Schlusswort
Helen Behn
Suicide by Cop Eine vergleichende Fallanalyse auf Grundlage der Pilotstudie vor dem Hintergrund veränderter Gesellschaftsstrukturen
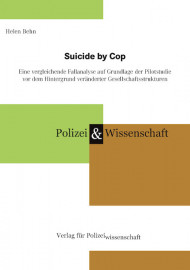
Suicide by Cop, die von einer Person provozierte eigene Tötung unter der Ausnutzung stets zur Verfügung stehender Polizeibeamten, ist ein Kriminalitätsphänomen, das sich seit ca. drei Jahrzehnten in der Öffentlichkeit durch Darstellungen in den Medien präsentiert. Es steht im aktuellen kriminalpolitischen Kontext des Themas Gewalt gegen Polizeibeamte und durchaus auch Gewalt durch Polizeibeamte. Die Diskussion um die Zunahme von Messerangriffen ist ein Aspekt im Rahmen dieser. Empirische Forschungsergebnisse liegen vornehmlich aus dem angloamerikanischen Sprachraum vor. Aus Deutschland wurden in Form der sog. Pilotstudie, mit der der Betrachtungszeitraum von zehn Jahren (2008–2017) und der Untersuchungsraum Niedersachsen erfasst wurde, empirische Forschungsergebnisse erstmalig durch die Autorin präsentiert. Methodisch stand eine Justizaktenanalyse, ergänzt durch eine Dokumentenanalyse, im Vordergrund. Während einerseits mittels eines überwiegend deskriptiven Vorgehens das Fallaufkommen determiniert und kategorisiert wurde (u. a. quantitative Erhebung von personenbezogenen und situationsbezogenen Faktoren), wurde auf der anderen Seite bei deutlich zu determinierenden Fällen mittels qualitativer Inhaltsanalyse die mögliche Motivlage extrahiert. Im Ergebnis wurden 90 (Verdachts-)Fälle hinsichtlich verschiedener Faktoren zum Thema Suicide by Cop determiniert und vertieft untersucht. Direkt an die beschriebene Pilotstudie knüpft die vorliegende Studie an. Vom Design her besteht nahezu kein Unterschied zu der ersten Studie. Damit werden im Ergebnis wertvolle Ergebnisse für den weiteren Forschungslückenschluss im Bereich des Kriminalitätsphänomens Suicide by Cop geliefert und ergänzend bietet sich ein Mehrwert durch den gezogenen Ergebnisvergleich und zudem unter der Betrachtung vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Diese ergeben sich vor allem aus den Ereignissen der Coronapandemie und dem Kriegsausbruch in Europa. Im Untersuchungszeitraum von 2018 bis 2022 konnte bei nahezu identischen Selektionskriterien eine erhöhte Fallanzahl festgestellt. Insgesamt wurden 250 versuchte SbC-Verdachtsfälle determiniert und analysiert. Zahlreiche dieser Fälle sind textlich aufbereitet, sodass dem Leser ein facettenreicher Einblick in die Phänomenologie des Suicide by Cop gewährt wird.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
2 Einordnung des Forschungsgegenstandes
3 Begriffsbestimmungen
3.1 Suicide by Cop
3.1.1 Allgemeines
3.1.2 Victim-precipitated homicide
3.1.3 Copicide
3.1.4 Police assisted homicide, police officer-assisted suicide, law enforcement-assisted suicide, suicide by police
3.1.5 Suicide by proxy
3.1.6 Sonstige Begrifflichkeiten
3.1.7 Begriffsbestimmung in der vorliegenden Studie
3.2 Täter und Opfer
3.2.1 Täter
3.2.2 Opfer
3.3 Zusammenfassung
4 Forschungsstand
4.1 Allgemeines
4.2 Internationaler Forschungsstand
4.3 Nationaler Forschungsstand
4.4 Zusammenfassung
5 Forschungsleitende Hypothesen
6 Methodische Umsetzung
6.1 Forschungsdesign
6.1.1 Dokumentenanalyse
6.1.2 Aktenanalyse
6.1.3 Methodische Limitationen
6.1.4 Zwischenfazit
6.2 Fallgenerierung
6.2.1 Begründung der Fallauswahl
6.2.2 Ergebnis der Fallgenerierung
6.3 Aktenanforderung
6.4 Aktenrücklauf
6.5 Erhebungsbogen
6.6 Pretest
6.7 Fallauswertung
6.8 Determinierung der Fälle – 4-Kategorien-System
6.8.1 Fallbeispiele der Kategorie 3
6.8.2 Fallbeispiele der Kategorie 4
6.9 Zusammenfassung
7 Ergebnisdarstellung
7.1 Personenbezogene Faktoren
7.2 Situationsbezogene Faktoren
7.3 Justizieller Teil
7.4 Motivlagen
8 Bewertung der Ergebnisse
8.1 Beantwortung der forschungsleitenden Hypothesen
8.2 Diskussion
8.3 Sonstiges
8.4 Ergebnisorientierte Limitationen
8.5 Zusammenfassung
9 Ausblick
Literaturverzeichnis
Trygve Ben Holland (Hrsg.)
Internationale polizeiliche Ermittlungen zur schweren transnationalen Kriminalität Bi- und plurilaterale Abkommen der Mitgliedstaaten der Europäischen Sicherheitsunion untereinander und mit Drittstaaten
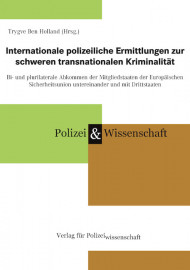
Vorliegendes Buch gibt – hauptsächlich in Form annotierter Listen – einen mit Fundstellen hinterlegten Gesamtüberblick über die zwei- und mehrseitigen polizeilichen Kooperationsabkommen zwischen den Mitgliedstaaten der EU und des EWR / der EFTA untereinander sowie im Hinblick auf Drittstaaten.
Am Beispiel Deutschland wird eine synoptisch-analytische Darstellung der Abkommenstypologie vorgenommen. In den Anhängen finden sich drei exemplarische Abkommen zwischen Deutschland und Albanien, Georgien und Polen sowie die inter-ministerielle Vereinbarung Nordrhein-Westfalen und Rumänien.
Inhalt
Inhalt:
Vorbemerkung
Methode
Einleitung
1 Synoptischer Blick auf Deutschland
A. Ratione Territoriae und Status Quo
A.1 Staaten Europäischer Erweiterungspolitik
A.2 Staaten Europäischer Nachbarschaftspolitik (Süd)
A.3 Staaten Europäischer Nachbarschaftspolitik (Ost) und Russland
A.4 EU-/EWR-Mitgliedstaaten und Schweiz
A.5 Amerikas
A.6 Arabische Staaten
A.7 Asiatischer Raum
B. Ratione Materiae bilateraler Abkommen mit deutscher Beteiligung
B.1 Abkommen unter deutscher Beteiligung mit Drittstaaten
B.2 Abkommen unter deutscher Beteiligung über die Zusammenarbeit der Polizei- (und Grenzschutz-)Behörden in Grenzgebieten
B.3 Abkommen unter deutscher Beteiligung auf Bundesebene und Vereinbarungen auf Bundeslandebene 19
B.4 (Geo-)Graphische Übersicht
C. Ausgewählte Abkommen anderer EU-/EFTA-Staaten
D. Kontext mit gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene
E. Datenschutzrechtliche Perspektive auf transnationale Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden
2 Abkommen
Rita Bley & Johannes Fischbach
Cybermobbing – Cybergrooming – Sexting Evaluation des Präventionsprojekts Law4swchool
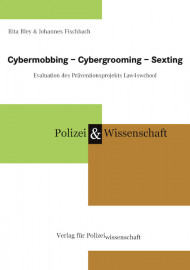
Inhalt
Inhalt:
1 Einführung
2 Begriffsbestimmungen
2.1 Cybermobbing
2.2 Cyberstalking
2.3 Cybergrooming
2.4 Sexting
3 Phänomenologie
3.1 Täter*innen
3.2 Opfer
3.3 Hell- und Dunkelfeld
4 Präventionsprojekt Law4school
4.1 Durchgeführte Webinare
4.2 Inhalte der Webinare
5 Evidenzbasierte Kriminalprävention
6 Evaluationsstudie
6.1 Projektablauf
6.2 Forschungsmodell
6.3 Datenauswertung
6.4 Wirkungsmessung
6.5 Bystanderintervention
6.6 Inhaltsanalytische Auswertung der Lehrer*inneninterviews
7 Zusammenfassung/Fazit
Literaturverzeichnis