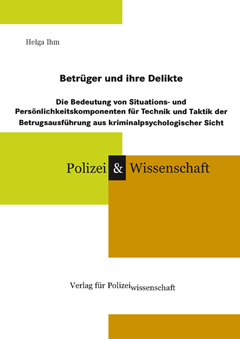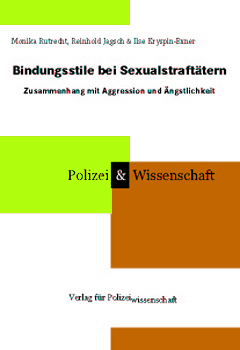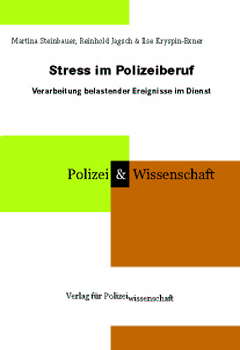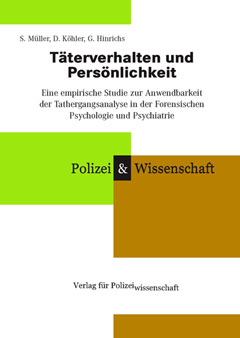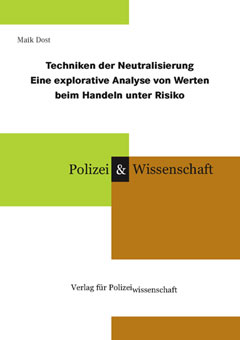Eberhard Kühne
Informationsverarbeitung und Wissensmanagement der Polizei beim Aufbruch in eine digitalisierte Welt

Was sind die Grundoperationen polizeilicher Informationsverarbeitung? Welche Perspektiven ergeben sich für Datamining? Wie sollen Wikis und Führungsinformationssysteme in der Polizei aufgebaut sein? Welche Fragen soll die Polizeiwissenschaft in diesem Zusammenhang bearbeiten und beantworten? Welche Aufgaben ergeben sich für Aus- und Fortbildung in der Polizei? Als Abschluss werden Grundsätze der ordnungsgemäßen Informationsverarbeitung in der Polizei formuliert in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, die für jeden Kaufmann zum kleinen Einmaleins gehören. Möge dieses Buch dazu beitragen, die Professionalität der Polizei im Umgang mit Informationen und Wissen weiter zu erhöhen und die Akzeptanz der Bürger für diese Arbeit zu verbessern. Der souveräne und rechtssichere Umgang der Polizei mit Informationen ist notwendiger denn je, um unsere Gesellschaft in Freiheit und Sicherheit zu gestalten.
Inhalt
Inhalt
Vorwort
Thesen zur Informationsverarbeitung einer modernen Polizei in einer demokratischen Gesellschaft
1 Polizeiarbeit als Informationsverarbeitung
1.1 Die rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen der polizeilichen Informationsverarbeitung
1.2 Sicherheit und Freiheit
1.3 Der gesetzliche Auftrag der Polizei erfordert die Nutzung aller benötigten Informationen
1.4 Das Magische Dreieck der polizeilichen Informationsgewinnung
1.5 Vorgangsbearbeitung als Informationsverarbeitungsprozess
1.6 Lagebewältigung als Informationsverarbeitungsprozess
1.7 Strafverfolgung, Gefahrenabwehr und Informationsverarbeitung
1.8 Polizeiliche Auswertung als Informationsverarbeitungsprozess – das moderne Auswerteverständnis der Polizei
1.9 Polizeiinterne Information und Kommunikation
1.10 Input, Verarbeitung, Output
1.11 Prozessgrenzen und Medienbrüche der Informationsverarbeitung
1.12 WEB 2.0: neue Möglichkeiten für Straftäter und Strafverfolger
1.13 Soziale Netzwerke – Normalität sozialer Kommunikation und Marktplatz der Eitelkeiten
1.14 Künftige Entwicklungen in Technik und Gesellschaft und ihr Einfluss auf die Aufgaben der Polizei
1.15 Gibt es die ideale Informationsverarbeitung der Polizei?
2 Input: Erkenntnisse aus allen Quellen gewinnen
2.1 pull oder push: erste Erkenntnisse – gebracht oder geholt?
2.2 System-Input in die Polizei und Eingabe in IT-Verfahren
2.3 Die klassischen Informationsquellen der Polizeiarbeit
2.4 Ausweitung des Potenzials vorhandener Informationsquellen
2.5 Erkenntnisgewinnung und Spurensicherung in den Neuen Medien
2.5.1 Polizei in Sozialen Netzwerken
2.5.2 Beispiele für Täterermittlungen mittels der Neuen Medien
2.5.3 Ein Beispiel der komplexen Informationsgewinnung durch Neue Medien
2.5.4 überwindung von Kryptografie als besondere Herausforderung an die Strafverfolgung
2.5.5 Die online-Identifizierung vom Computernutzern und Computern
2.5.6 Bilder und ihre zusätzlichen Informationen
2.5.7 Computer Forensik – Spurensicherung im 21. Jahrhundert
2.6 Informationen aus fragwürdigen Quellen – Beispiel Steuer-CD
2.7 Die Bewertung des Input
2.8 Die ultimative Herausforderung: Der Blick ins Gehirn
3 Informationsverarbeitung: Wissensbildung durch aktives Handeln
3.1 Daten, Informationen und Wissen
3.2 Datensammlungen und Datenmodelle
3.3 Anforderungen an IT-Verfahren zur Unterstützung polizeilicher Handlungen
3.4 Eine kurze übersicht über die Fahndungs- und Vorgangsbearbeitungssysteme der Polizeien in Deutschland
3.5 Grundoperationen polizeilicher Informationsverarbeitung
3.5.1 Was sind die Grundoperationen der polizeilichen Informationsverarbeitung?
3.5.2 Der Vergleich als die zentrale Methode polizeilicher Informationsverarbeitung
3.6 Das große Problem: Zusammenhänge erkennen … und darstellen!
3.7 Die Auswertung von Massendaten – ein Beispiel
3.8 Die Zusammenführung von Daten als wichtigste Voraussetzung zur Wissensbildung
3.8.1 Grundlagen der Zusammenführung von Daten
3.8.2 Datenzusammenführung – erst Rasterfahndung dann Data-Mining?
3.8.3 Automatische Generierung eindeutiger personenbezogener Schlüsselnummern als technische Grundlage einer Datenzusammenführung
3.8.4 Gesetzliche Rahmenbedingungen für das Zusammenführen von Informationen am Beispiel der Anti-Terror-Datei
3.8.5 Exkurs: Volkszählung 2010/11
3.8.6 Exkurs: Google als Datensammler
3.8.7 Künftige Software und Verfahren zur automatisierten Auswertung großer heterogener Datenbestände
3.9 Methoden zur Wissensbildung in der Polizei
3.9.1 Kriminalistisches Denken
3.9.2 Die Kriminalistische Fallanalyse
3.9.3 The Intelligence Cycle
3.9.4 Versions- oder Hypothesenbildung?
3.9.5 Ermittlungsarbeit als SUDOKU?
3.9.6 Die Beschuldigtenvernehmung als Spieltheorie
3.9.7 Außergewöhnlich: der Beschuldigte als Ermittler
3.10 Ein abstraktes Modell polizeilicher Wissensbildung
4 Der Output: die Produkte polizeilicher Informationsverarbeitungsprozesse
4.1 Ziele und Produkte polizeilicher Vorgangsbearbeitung
4.2 Interne und externe Produkte
4.3 Informationsbedarf für Controlling und Produktorientierte Steuerung
4.4 Die Erkenntnisse der Strafverfolger dem Gericht präsentieren
4.4.1 Gesichertes Wissen falsch interpretiert
4.4.2 Falsches Wissen im Gerichtsverfahren - Der Fall „Bauer Rudi“
5 Wissensmanagement in der Polizei
5.1 Die Polizei als lernende Organisation
5.2 Wissensmanagement – die Grundlagen
5.2.1 Die Ressource Wissen
5.2.2 Aufgaben des Wissensmanagements in der Polizei
5.2.3 Wissensmanagement – eine Definition
5.2.4 Informationsmanagement vs. Wissensmanagement?
5.3 Wissen in der Polizei präsentieren und kommunizieren
5.3.1 Informationspannen der Polizei – wer arbeitet, macht Fehler!
5.3.2 Polizeiliches Meldewesen
5.3.3 KPMD - der Paradigmenwechsel von der Perseveranzhypothese zum modernen Auswerteverständnis
5.3.4 Auskunftssysteme
5.3.5 Beispiel Nicht-numerische Sachfahndung
5.3.6 Intranets der Polizei als angewandtes Wissensmanagement
5.3.7 Wiki in der Polizei – eine Form des Wissensmanagements
5.4 Grundrisse des Qualitätsmanagements in der Polizei
5.4.1 Braucht die Polizei ein Qualitätsmanagement?
5.4.2 Datenqualität als Schwerpunkt
5.4.3 Gestaltung von Schnittstellen
5.5 Mobile Datenverarbeitung
5.5.1 Anforderungen
5.5.2 Car- PC und operatives Flottenmanagement
5.5.3 eBook-Reader
5.5.4 Was sollte ein PolicePhone können?
5.6 Der Schutz des Organisationswissens
5.6.1 Bedrohungen der Datensicherheit
5.6.2 Umstrukturierungen und Strukturreformen
5.6.3 Personalrotation
5.7 Führungs-Informationssysteme (FIS)
5.7.1 FIS in der Wirtschaft
5.7.2 Konzeptioneller Ansatz eines Führungsinformationsystems der Polizei
5.8 IT-Verfahren - ihr Nutzen und die Grenzen ihrer Effizienz
5.9 Wissensmanagement und Polizeiwissenschaft
5.10 Wissensmanagement in der Aus- und Fortbildung
6 Die Grundsätze ordnungsgemäßer Informationsverarbeitung in der Polizei Fazit – Polizeiinformatik, Polizeiwissenschaft und Wissensmanagement auf die Agenda!
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Quellenverzeichnis
Anlagen
Thomas Körner
Suizid Eine epidemiologisch-phänomenologische Analyse personenbezogener, lebenskontextuell-motivationaler und verhaltensorientierter Aspekte unter besonderer Berücksichtigung des Geschlechts

Inhalt
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Suizid aus historischer und philosophischer Perspektive
2.1 Suizid in der Antike
2.2 Suizid im Mittelalter
2.3 Suizid seit der Neuzeit
2.4 Resümee
3 Suizid aus rechtlicher Perspektive
3.1 Suizid aus verfassungs- und strafrechtlicher Perspektive
3.2 Suizid und die freie Willensbildung
3.3 Rechtliche Aspekte der Zwangsunterbringung bei akuter Suizidalität
3.4 Resümee
4 Suizidologische Begriffsbestimmung
4.1 Suizidalität
4.1.1 Suizidideen/-gedanken/-phantasien
4.1.2 Suizidversuch/Parasuizid
4.1.3 Suizid
4.2 Selbstmord, Selbsttötung und Freitod
4.3 Selbstmordäquivalent, protrahierte Selbsttötung
4.4 Resümee
5 Ätiologie des Suizids
5.1 Biologische Ansätze
5.1.1 Evolutionsbiologische Überlegungen
5.1.2 Erkenntnisse der Vererbungslehre
5.1.3 Neurophysiologische Erkenntnisse
5.2 Soziologische Ansätze
5.2.1 Die Integrations- und Anomie-Theorie der Suizidalität von Durkheim
5.2.2 Der Status-Change-Ansatz von Breed
5.3 Psychologische Ansätze
5.3.1 Psychoanalytische bzw. psychodynamische Ansätze
5.3.2 Lerntheoretische Ansätze
5.3.3 Kognitive Ansätze
5.4 Resümee
6 Epidemiologie und Phänomenologie des Suizids
6.1 Epidemiologisch-suizidologische Forschung
6.1.1 Arten der Epidemiologie und epidemiologischer Forschung
6.1.2 Suizidologisch-epidemiologische Untersuchungsstrategien, Forschungsdesigns und Kennzahlen
6.1.3 Probleme der Erfassung von Suiziden für die epidemiologische Forschung
6.1.4 Genderforschung und Suizidologie
6.1.5 Resümee
6.2 Suizidepidemiologische Basisdaten
6.2.1 Suizid - international
6.2.2 Suizid - Europa
6.2.3 Suizid - Deutschland
6.2.4 Resümee
6.3 Lebenskontextuell-motivationale Aspekte des Suizids im Lebensverlauf
6.3.1 Motive und Intentionen suizidalen Verhaltens
6.3.2 Psychosoziale Rahmenbedingungen und Hintergründe für Suizide
6.3.3 Entwicklungspsychologische Aspekte von Suizid
6.3.4 Resümee
6.4 Suizid und psychische Störungen
6.4.1 Psychische Störungen als suizidförderliche Bedingungen im Kindes- und Jugendalter
6.4.2 Psychische Störungen als suizidförderliche Bedingungen im Erwachsenenalter
6.4.3 Komorbiditäten und deren Relevanz für Suizidalität
6.4.4 Resümee
6.5 Suizidmethoden
6.5.1 Klassifikationsmöglichkeiten von Suizidmethoden
6.5.2 Epidemiologisch-phänomenologische Aspekte der Suizidmethodennutzung
6.5.3 Faktoren für die Wahl der Suizidmethode
6.5.4 Phänomenologie einzelner Suizidmethoden
6.5.5 Resümee
6.6 Suizidörtlichkeit
6.6.1 Faktoren für die Wahl der Suizidörtlichkeit
6.6.2 Suizidörtlichkeiten im Kontext von Suizidmethoden
6.6.3 Suizidörtlichkeiten im Kontext von bestimmten Lebenssituationen
6.6.4 Resümee
6.7 Aspekte des Suizidtermins
6.7.1 Suizid und kalendarischer Jahresverlauf
6.7.2 Suizid und Wochenverlauf
6.7.3 Suizid und Tagesverlauf
6.7.4 Resümee
6.8 Resümee
7 Epidemiologisch-phänomenologische Analyse von Suiziden
7.1 Inhalt und allgemeine Zielstellungen
7.2 Daten und Datenerhebung
7.3 Stichprobe
7.4 Auswertung, Ergebnisse, Ergebnisinterpretation
7.4.1 Auswertekomplex 1: Reliabilitätsanalyse
7.4.2 Auswertekomplex 2: Epidemiologisch-deskriptive Auswertung
7.4.3 Auswertekomplex 3: Epidemiologisch-phänomenologische Analyse
7.5 Zusammenfassung
7.5.1 Zusammenfassung Reliabilitätsprüfung
7.5.2 Zusammenfassung epidemiologisch-deskriptive Analyse
7.5.3 Zusammenfassung epidemiologisch-phänomenologische Analyse
7.5.4 Zusammenfassende Interpretation der Ergebnisse
7.6 Methodendiskussion
7.6.1 Sekundärdaten
7.6.2 Repräsentativität
7.6.3 Stichprobe
7.6.4 Missing Values
7.6.5 Reliabilität der Erfassungsinstrumente
7.6.6 Testvoraussetzungen
7.6.7 Interpretation überzufälliger Auftretenshäufigkeiten
7.6.8 Vergleich der Geschlechter
7.6.9 Kausalitätsprüfung
7.6.10 Auswertevariablen
7.6.11 Inflation
7.6.12 Interdependenzen und Drittvariablen
7.6.13 Absolute Suizidzahlen
7.7 Resümee
7.8 Ausblick
8 Literaturverzeichnis
9 Anhang
9.1 Anhang A: Katalog Tatörtlichkeit - Polizeiliche Kriminalstatistik Thüringen 2006
9.2 Anhang B: Differenzmaße: PKS-GBE-Datensatz
9.3 Anhang C: Familienstands- und altersbezogene Thüringer Gesamtbevölkerungszahlen - Mann/Frau
9.4 Anhang D: Mittelwertvergleich Alter x Geschlecht
9.5 Anhang E: Residualbewertung und Signifikanzprüfung - Suizidmethode
9.6 Anhang F: Residualbewertung und Signifikanzprüfung - Suizidörtlichkeit
9.7 Anhang G: Residualbewertung und Signifikanzprüfung - Suizidtermin
Helga Ihm
Betrüger und ihre Delikte Die Bedeutung von Situations- und Persönlichkeitskomponenten für Technik und Taktik der Betrugsausführung aus kriminalpsychologischer Sicht

Inhalt
1. Einleitung
1.1 Zum Begriff des Betrugs und die rechtlichen Grundlagen
1.1.1 Begriffserklärung
1.1.2 Der juristische Begriff des Betrugs
1.1.3 Manipulation und Betrug
1.2 Phänomenologie
1.2.1 Prävalenz von Betrug gemäß der Polizeilichen Kriminalstatistik
1.2.2 Geschlecht- und Altersverteilung
1.2.3 Formen von Betrug
1.2.4 Deliktperseveranz und kriminelle Karriere
1.3 Kriminologische Differenzierung von Betrug
1.3.1 Das Opfer des Betrügers
1.3.2 Der Betrüger
1.3.3 Technik und Taktik der Betrugsausführung
1.4 Psychologische Theorien zur Entstehung von Betrug
1.4.1 Das Routine-Aktivitäts-Modell (Cohen und Felson, 1979)
1.4.2 Theorie der rationalen Entscheidung
1.5 Die Psychologie des Betrügers
1.5.1 Persönlichkeitseigenschaften von Betrügern
1.5.2 Narzisstische Persönlichkeitsstörung
1.6 Psychologische Theorien zur Täter-Opfer-Interaktion
1.6.1 Das Opfer als Interakteur
1.6.2 Der Täter als Interakteur
1.7 Psychologische Erklärungsmodelle für die Täter-Opfer-Interaktion
1.7.1 Das Elaboration-Likelihood-Modell von Petty und Cacioppo
1.7.2 Soziale Einwirkung als Betrugsstrategie
1.8 Psychologisches Modell der Ereignisstadien des Betrugs
1.8.1 Persönlichkeit und Delinquenz
1.8.2 Handlungspsychologisches Modell
2. Fragestellung und Hypothesen
Einleitung
3. Methode
3.1 Durchführung
3.2 Datenerhebung
3.3 Untersuchungsstichproben
3.4 Beschreibung der Justizvollzugsanstalten (JVA)
3.5 Untersuchungsinstrumente
3.5.1 Das Trierer Integrierte Persönlichkeitsinventar
3.5.2 Fallanalytischer Fragebogen
3.6 Datenauswertung
4. Ergebnisse
4.1 Deskriptive Analyse des Materials
4.2 Ergebnisse der Diskriminanzanalyse
4.3 Ergebnisse der logistischen Regressionsanalysen
5. Diskussion
5.1 Anmerkungen zur Durchführung
5.2 Repräsentative Stichproben in der forensischen Wissenschaft
5.3 Die Stichprobe der Betrüger
5.4 Die Anwendung von Fragebögen im intramuralen Setting
5.5 Einfluss sozialer Erwünschtheit
5.6 Die Anwendung des TIPI bei der Stichprobe der Betrüger
5.7 Erkenntnisse zu den Persönlichkeitseigenschaften von Betrügern
5.8 Der Zusammenhang zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Tatverhalten
5.9 Ausblick
6. Zusammenfassung
7. Abbildungsverzeichnis
8. Tabellenverzeichnis
9. Literatur
10. Anhang
Clemens Lorei (Hrsg.)
Eigensicherung & Schusswaffeneinsatz bei der Polizei Beiträge aus Wissenschaft und Praxis 2011

Die Tagung Eigensicherung & Schusswaffeneinsatz produzierte folgende Zahlen:
Anzahl von Tagungen: 5
Anzahl von Jahren der Tagung: 10
Anzahl von Vorträgen: 53
Anzahl von Teilnehmern: 870
Anzahl von Seiten der Tagungsbände: 1240
Und wie immer stellt sich dann auch hier die Frage: Was sagt uns diese Statistik?
Sie sagt eindeutig: Eigensicherung ist und bleibt ein wichtiges Thema.
Ich danke allen, die zu dieser Tagung und dem Tagungsband beitrugen und das Thema Eigensicherung stets aktuell und bedeutsam halten.
Inhalt
Inhalt:
Die Gegenwart meistern - Anmerkungen zur erfolgreichen Bewältigung von Extremsituationen
Verhaltensmerkmale muslimischer Kofferbomben-Attentäter - Ergebnisse einer Feldstudie
Zur Axiologie und Morphologie des polizeilichen Schusswaffengebrauchs
Zusammenarbeit von Polizei und Rettungsdienst bei Amoklagen
Gewalt gegen Polizei aus Sicht der Täter
Gewalt im Polizeialltag - Psychologische Auswirkungen von direkten und indirekten Gewalterfahrungen auf Polizistinnen und Polizisten
Medizinische Probleme im Polizeigewahrsam
„Suicide-by-Cop“ - Einschätzung von Gefährdungslagen bei polizeilichen Suizid-Einsätzen
Kontrolle des „Jagdtriebs“ bei Polizeibeamten
Präventive Aspekte der Personalauswahl und Ausbildung von Spezialkräften der Bundeswehr
Leistungsoptimierung durch funktionelle mentale Vorbereitung am Beispiel Farbmarkierungstraining
Comparing of Police Use of Firearms in the EU

Die Bindungstheorie, die ursprünglich zum Verständnis der Eltern-Kind-Beziehung
beitragen sollte, wurde in letzter Zeit auch durch seine Bedeutung für
die Erklärung psychopathologischer Entwicklungen bekannt. Sie gewinnt als
relativ neuer Ansatz empirisch häufig gestützt den Charakter eines
Erklärungsmodells für die Entwicklung sexuell devianter Verhaltensweisen.
Das vorliegende Buch versucht nach einem theoretischen Einblick in die Bindungstheorie
anhand einer Stichprobe von verurteilten Sexualstraftätern und anderen
Delinquenten den angenommenen Zusammenhang zwischen Bindung und Sexualdelinquenz
nachzuvollziehen. Des Weiteren wird nach einer Verbindung zwischen Bindungsstil
und Tätergruppe einerseits und der Aggressivität und ängstlichkeit
andererseits gesucht.
Inhalt
1 Einleitung
Theoretischer Teil
2 Die Bindungstheorie
2.1 Zur Person John Bowlby und der historischen Entwicklung der Bindungstheorie
2.2 Grundlagen der Bindungstheorie
2.2.1 Biologische Funktion des Bindungsverhaltens
2.2.2 Das Bindungssystem
2.3 Die verschiedenen Bindungsstile
2.3.1 "Die Fremde Situation"
2.4 Mütterliche Feinfühligkeit und Pflegeverhalten
2.4.1 Innere Arbeitsmodelle und Bindungsrepräsentanzen
2.4.2 Hierarchien der Bindungsperson und Bindungsverhalten im Lauf des Lebens
2.4.3 Stabilität des Bindungsverhaltens
2.4.4 Tradierung von Bindung
2.5 Zusammenhänge zwischen Bindungsstilen und psychischen Auffälligkeiten
3 Bindung und Sexualdelinquenz
3.1 Sexuell deviantes Verhalten - begriffliche und rechtliche Definition
3.1.1 Problematik einer Definitionsfindung
3.1.2 Die Täter
3.1.3 Zur Häufigkeit sexuell devianten Verhaltens
3.1.4 Die Gesetzeslage in österreich
3.2 Einschlägige Forschungsergebnisse
3.2.1 Sexualverbrechen, Bindungsstile und Intimitätsdefizite - Eine Studie
von Ward et al. (1996)
3.2.2 Exkurs: Bindungstheorie von Bartholomew
3.2.3 Bindungen im Kindes- und Erwachsenenalter bei Sexualdelinquenten
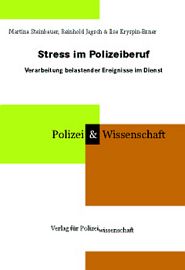
Obwohl bekanntermaßen der Beruf des Polizeibeamten einer der subjektiv
belastendsten und stressigsten ist, existieren insbesondere im deutschsprachigen
Raum nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit diesem Thema
befassen und die Frage
untersuchen, wie Polizisten auf belastende Ereignisse im Dienst reagieren. Diese
Studie soll dazu beitragen, diese Lücke zu schließen und geht u.a.
den Fragen nach, welche Situationen und Ereignisse von Beamten der österreichischen
Bundespolizei als Stress empfunden werden und wie belastend diese sind, welche
Auswirkungen die Stressoren auf
das dienstliche und private Leben haben und welche Wege der Verarbeitung eingeschlagen
werden. Weiterhin wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Akuten und
Posttraumatischen Belastungsstörungen nach dem Erleben von sehr belastenden
Ereignissen im Dienst erforscht. Die Fragen werden hinsichtlich Unterschieden
auf Grund des Geschlechtes, der Diensterfahrung und des Verwendungszweiges (Sicherheitswache
und Kriminalpolizei) untersucht.
Inhalt
EINLEITUNG
I. THEORETISCHER TEIL
1 STRESS
1.1 Begriffsdefinitionen und geschichtliche Entwicklung
1.2 Die Reaktion des Körpers auf Streß
1.3 Psychologischer Streß und psychologische Streßtheorien
1.4 Streß und Angst
2 DIE POLIZEI
2.1 Historisches
2.2 Organisation
2.3 Zahlen, Fakten und Aufgaben der Beamten
2.4 Die Ausbildungen
3 DER POLIZEIBEAMTE'
4 STRESS IM POLIZEIBERUF4.1 Auswirkungen auf das Individuum und
das Problembewußtsein des einzelnen
4.2 Die Entstehung von psychischen Traumen
4.3 Der individuelle Umgang mit traumatisierenden Situationen
4.4 Spezifischer bisheriger Forschungsstand
5 STRESSVERARBEITUNG
5.1 Prävention von PTSD
5.2 Die Verarbeitung von besonderen Belastungen im Polizeiberuf
5.3 Traumatherapie (am Beispiel des Instituts für Psychotrauma in Utrecht)
5.4 Möglichkeiten der Verarbeitung von Belastungen bei der österreichischen
Bundespolizei
II. EMPIRISCHER TEIL
1 PROBLEMDARSTELLUNG UND FORSCHUNGSHYPOTHESEN
2 UNTERSUCHUNGSTEILNEHMER
2.1 Die erste Erhebung im März 2001
2.2 Die zweite Erhebung im Juli/August 2001
3 UNTERSUCHUNGSPLAN
3.1 Die erste Erhebung im März 2001
3.2 Die zweite Erhebung im Juli/August 2001
4 UNTERSUCHUNGSMATERIALIEN
4.1 Die erste Erhebung im März 2001
4.2 Die zweite Erhebung im Juli/August 2001
5 ELEKTRONISCHES INSTRUMENTARIUM
III. ERGEBNISSE
DARLEGUNG DER DESKRIPTIVEN STATISTIK SOWIE DER STATISTISCHEN
HYPOTHESENPRüFUNG
1 DIE ERSTE ERHEBUNG IM MäRZ 2001
1.1 Fragestellung 1: Welche beruflichen Situationen und Ereignisse werden von
den Beamten der österreichischen Bundespolizei als "Streß"
empfunden, und wie stark sind diese für die Polizisten belastend?
1.2 Fragestellung 2: Welche Auswirkungen haben die Stressoren auf das dienstliche
und private Leben der Beamten?
1.3 Fragestellung 3: Welche Wege der Streßverarbeitung werden von den
Polizisten eingeschlagen?
2 DIE ZWEITE ERHEBUNG IM JULI/AUGUST 2001
IV. INTERPRETATION UND DISKUSSION DER
ERGEBNISSE
EINLEITUNG
1 DIE ERSTE UNTERSUCHUNG IM MäRZ 2001
2 DIE ZWEITE UNTERSUCHUNG IM JULI/AUGUST 2001
3 GESAMTZUSAMMENFASSUNG
V. ABSTRACT
VI. LITERATURVERZEICHNIS
VII. ANHANG
FRAGEBOGEN "STRESS IM POLIZEIBERUF"
FRAGEBOGEN "VERARBEITUNG BELASTENDER EREIGNISSE
IM POLIZEIDIENST

Die kriminalpsychologische Methode der Tathergangsanalyse wurde bislang vorwiegend
im Bereich der Polizeiarbeit angewendet. Seit Ende der 1990er Jahre findet
sie nun auch zunehmend im forensisch psychologischen und psychiatrischen Bereich
Verwendung, eine empirische überprüfung fand bisher jedoch kaum
statt.
In der vorliegenden Untersuchung werden diese vernachlässigten Forschungslücken
aufgegriffen und die Grundannahmen der Tathergangsanalyse erstmalig wissenschaftlich
überprüft. Der Beitrag bietet zugleich einen umfangreichen überblick
über den Gegenstand der Tathergangsanalyse, der sowohl den theoretischen
Hintergrund als auch die Methodik selber in einen historischen Zusammenhang
stellt. Hierbei legen die Autoren den Fokus besonders auf die interdisziplinären
Zugänge zur Thematik und arbeiten den primären Nutzen für die
forensische Psychologie und Psychiatrie heraus.
In einer Pilot- und einer Hauptstudie wurden schwere Gewalt- und Sexualverbrecher
hinsichtlich der Persönlichkeit und des Täterverhaltens untersucht.
Wichtige Variablen bildeten dabei neben den Persönlichkeitseigenschaften
und den Persönlichkeitsstörungen, Psychopathy und Planungsgrad,
Kontaktaufnahmestrategien sowie Personifizierungsformen.
Zum ersten Mal wurde damit eine empirische Arbeit vorgelegt, die hypothesengeleitet
die Grundannahmen der Tathergangsanalyse untersucht und die Ergebnisse in
Bezug zur forensischen Psychologie und Psychiatrie setzt. Abschließend
gehen die Autoren auf die Anwendbarkeit der Tathergangsanalyse in der forensischen
Psychotherapie ein und hinterfragen ihren Einsatz in der forensischen Begutachtung
von Schulfähigkeit und Prognose.
Inhalt

»Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen,
die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen«.
Dieser Satz Albert EINSTEINs bildet die zentrale Intention vorliegender Arbeit,
die die Rationalisierungsmittel zur Verweigerung der Kenntnisnahme von Menschenfeindlichkeit
untersucht. Die ursprünglich auf die Theorie zur Erklärung abweichenden
Verhaltens von Gresham M. SYKES und David MATZA (1957) zurückzuführenden
»Techniken der Neutralisierung«, wurden vom deutschen Kriminologen
Herbert JäGER (1989) erweitert und als Erklärungsansatz für
eben jene Formen der Makrokriminalität adaptiert. Die empirische überprüfung
der Theorie, die auch im Zusammenhang mit Phänomenen wie sozialer Distanz,
Autoritarismus und Anomie angesiedelt ist, stand bis jetzt jedoch noch aus.
In einem Feldversuch wurden deshalb fremdenfeindliche Situationen gespielt,
die rassistische und sexistische Stereotype zur Sprache brachten, um hierdurch
Licht auf die Mittel zur Verweigerung von Hilfeleistung zu werfen. Die vorwiegend
qualitativ gestaltete Analyse dieser Versuche führte zu Ergebnissen,
die die Grundlage für weitere empirische Untersuchungen sein können
und die die terra incognita des zivilgesellschaftlichen Handelns etwas erhellen
sollten.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
I. Einleitung
I.1. Warum dieses Thema?
I.2. Forschungsziel und Beitrag zur Wissenschaft
I.3. Zur Erfassung des Forschungsgegenstands und zum Aufbau der Arbeit
II. Theorie
II.1. Politische Kultur
II.2. Werte
II.3. Techniken der Neutralisierung
III. Methode
III.1. Grundlegende Forschungsergebnisse und ihre Methoden
III.2. Methodische Vorüberlegungen
III.3. Untersuchungsdesign
IV. Analyse
IV.1. Versuchsanalyse
IV.2. Beobachtungsergebnisse
IV.3. Deskriptive Ergebnisse
IV.4. Interpretative Ergebnisse
IV.5. Zusammenfassung der Ergebnisse
V. Schlussbetrachtungen und Ausblicke
V.1. Hypothesenprüfung und Aussagekraft der Ergebnisse
V.2. Vergleich und Schlussfolgerungen
V.3. Anknüpfungspunkte für Prävention und Forschung
Literatur
Anhänge