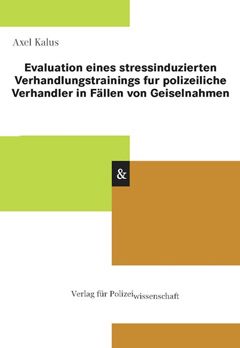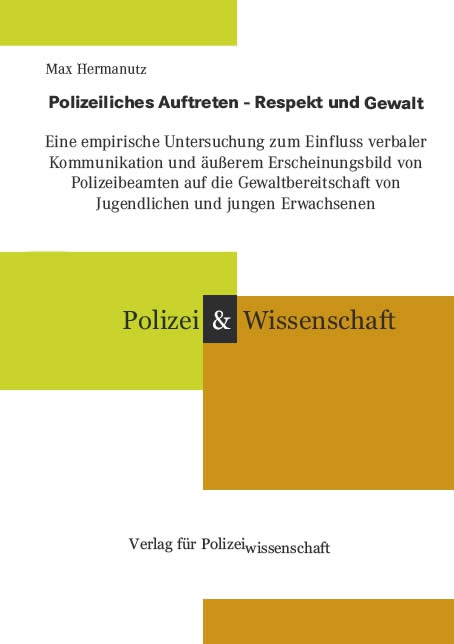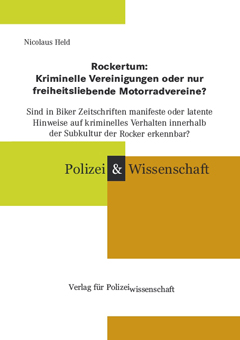Diebstähle und Raubüberfälle gibt es schon so lange wie die Menschheit selbst, aber heute finden Raubüberfälle auf Banken, Postämter, Wettbüros, Trafiken und Tankstellen immer mehr Raum in der medialen Berichtserstattung. Allein bis März 2014 wurden bereits unzählige Raubüber-fälle in österreich verübt und trotz aller Bemühungen der Exekutive liegt die Aufklärungsquote bei Raubdelikten in österreich unter 50 %. Ursache dafür sind mehrere ermittlungserschwerende Hürden: Der/Die TäterIn sind meist maskiert, es gibt mangelhafte Zeugenaussagen und die Videoaufzeichnungen sind oft von mangelhafter Qualität. Zudem sind die TäterInnen der Exekutive zumeist einen Schritt voraus. Die Erkenntnis, ob es sich nun um eine/n EinzeltäterIn oder um SerientäterInnen handelt, wird oft erst im Laufe der Ermittlungen erlangt. Aber was motiviert die TäterInnen? Woher kommen sie? Gibt es gemeinsame Merkmalsausprägungen, die ein mögliches Profil ergeben könnten?
Die Antworten zu diesen Fragen erhalten Sie in diesem Werk.
Inhalt
Inhalt:
1 Vorwort
2 Einleitung
2.1 Forschungsprobleme
2.2 Die Hauptforschungsfrage
2.3 Methode
3 Zahlen und Daten in österreich
3.1 RaubüberfaÅNlle 2012
3.2 Angezeigte Fälle in den Jahren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
3.3 Aufklärungsquote in den Jahren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
4 Der Raub aus strafrechtlicher Sicht
4.1 Anmerkung
4.2 Der Raub gemäß § 142 Abs. 1 StGB
4.3 Der minderschwere Raub gemäß § 142 Abs. 2 StGB
4.4 Der schwere Raub gemäß § 143 StGB
5 Was ist Profiling?
5.1 Definition von Profiling
5.2 Täterprofile
5.3 Einleitende Worte und Begriffsdefinitionen
5.4 Historisches über Täterprofiling
5.5 Anwendungsbereich von Täterprofilen
6 Das Erstellen von Täterprofilen
6.1 Der/Die FallanalytikerIn – Kenntnisse und Fähigkeiten
6.2 Ausbildung zum Fallanalytiker in Deutschland
6.3 Aufgaben der FallanalytikerInnen
6.4 Hilfe durch elektronische Datenverarbeitung
6.5 Fallbeispiel – Erfolg durch Täterprofiling
6.6 Anwendung von Täterprofiling in österreich
6.7 Veröffentlichung des Täterprofils
6.8 Erfolg von Täterprofilen und Fehlerquellen
7 Geographical Profiling
7.1 Was ist Geographical Profiling?
7.2 Historisches über die geografische Fallanalyse
7.3 Räumliche Bewegungen der TäterInnen und Erkenntnisse
8 Kriminologie
8.1 Einleitende Worte
8.2 Begriff und Aufgaben der Kriminologie
8.3 Grundzüge über die Geschichte der Kriminologie
8.4 Wieso begehen Menschen Straftaten
8.5 Warum begehen Menschen keine Straftaten
9 Empirische Untersuchung von RäuberInnen
9.1 Auswertung der Interviews
9.2 Sozialer Hintergrund der befragten Probanden
9.3 Biografie der befragten Probanden
9.4 Tatplanung
9.5 Flucht
9.6 Geografisches Verhalten der befragten Probanden
9.7 Allgemeines
9.8 Kategorisierung der TäterInnen
9.9 Fazit der Interviews
9.10 Resultat der Aktenauswertung beim Landesgericht für Strafsachen Wien
9.11 Resultate des GeoProfilings - Berechnung zwischen Wohnort und Tatort
9.12 Darstellung des GeoProfilings in 11 Fällen
10 Ergebnis
11 Schlussfolgerung
12 Verzeichnisse

Inhalt
Inhalt:
1 Einführung
1.1 Problemaufriss
1.2 Zielsetzung
1.3 Fragestellung
1.4 Datengrundlage und methodische Vorgehensweise
1.5 Aufbau der Arbeit
2 Forschungsstand
2.1 Studien zu Rockerkriminalität
2.2 Begriffsdefinitionen
3 Phänomenologie
3.1 Entwicklung von Straftaten im Rockermilieu im Hellfeld
3.2 Anzeigeverhalten
3.3 Erscheinungsformen
3.4 Modus operandi
3.5 Tatfolgen
3.6 Handlungshintergründe (Tatauslöser, Tatmotive)
4 Tätermerkmale
4.1 Soziodemografische Daten
4.2 Freizeitrocker versus Berufsrocker
4.3 Netzwerk Rockergruppierung
5 Elemente des Rockersyndroms
5.1 Kollektive Identität
5.2 Gewaltfördernde Einstellung und Waffenaffinität
5.3 Internalisierung des Normensystems
5.4 Konformitätsneigung
5.5 Abschottung
5.6 Kompetente Imagepflege
5.7 Hegemoniale Männlichkeit
5.8 Zwischenfazit
6 Erklärungsansätze
7 Ansatzpunkte polizeilicher Prävention
8 Fazit und Ausblick
Literatur
Axel Kalus
Evaluation eines stressinduzierten Verhandlungstrainings für polizeiliche Verhandler in Fällen von Geiselnahmen

Das vorliegende Forschungsprojekt untersucht die Wirksamkeit eines Verhandlungstrainings für Mitglieder von Verhandlungsgruppen. Im Fokus dieser Arbeit steht eine Fortbildungsveranstaltung, die neben der kognitiven Vermittlung von Kommunikationstheorien das Einüben deeskalativer Kommunikationstechniken unter realitätsnahen stressbesetzten übungssituationen beinhaltet. Es wird davon ausgegangen, dass polizeiliche Verhandler, die durch eine solche Fortbildung auf typische Verhandlungsgespräche mit dem Täter vorbereitet werden, erfolgreicher unter dem Stress der Einsatzlage mit dem Täter interagieren und folglich häufiger eine Eskalation der Verhandlungsgespräche vermeiden können.
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Polizeiliche Einsatzlage „Geiselnahme“
2.1.1 Perspektiven der Einsatzlage „Geiselnahme“
2.1.2 Verhandlungen als Lösungsoption
2.2 Kommunikation in Geiselnahmeverhandlungen
2.2.1 Traditionelle Modelle
2.2.2 Das S.A.F.E.-Modell von Rogan und Hammer
2.3 Geiselnahmeverhandlungen: Kommunikation in der Krise
2.3.1 Affektive Zustände der Interaktionspartner während einer Geiselnahme
2.3.2 Kommunikation unter Stress
2.4 Training von Verhandlungskompetenzen
2.5 Zusammenfassung theoretischer Annahmen
3 Fragestellung und Hypothesenbildung
3.1 Annahmen zu Veränderungsprozessen innerhalb der Kontrollgruppe
3.2 Annahmen zu Veränderungsprozessen innerhalb der Experimentalgruppe 1: „kognitives Training S.A.F.E.“
3.3 Annahmen zu Veränderungsprozessen innerhalb der Experimentalgruppe 2: „kognitiv-behaviorales Training S.A.F.E.“
3.4 Annahmen zum Vergleich der Trainingsmaßnahmen
3.5 Individuelle Einflussfaktoren auf die Trainingswirkung
4 Methodik
4.1 Planung der Untersuchung
4.1.1 Zielgruppe
4.1.2 überlegungen zur Ausgestaltung der summativen Evaluation im Sinne eines Pre-Post-Untersuchungsdesigns
4.1.3 überlegungen zur Ausgestaltung der Trainingsmaßnahmen
4.1.4 überlegungen zur Erhebung der Trainingswirkung
4.1.5 überlegungen zur statistischen Datenauswertung
4.2 Durchführung
4.2.1 Rekrutierte Stichprobe
4.2.2 Umsetzung des geplanten Untersuchungsdesigns mit Fokus auf die Randomisierung
4.2.3 Durchführung eines Testlaufes der Trainingsmaßnahme
4.2.4 Durchführung der Erhebung der Trainingswirkung
4.2.5 Durchführung der statistischen Datenauswertung
5 Ergebnisse
5.1 Ergebnisse zu Veränderungsprozessen innerhalb Kontrollgruppe
5.2 Ergebnisse zu Veränderungsprozessen innerhalb der Experimentalgruppe 1: „kognitives Training S.A.F.E.“
5.3 Ergebnisse zu Veränderungsprozessen innerhalb der Experimentalgruppe 2: „kognitiv-behaviorales Training S.A.F.E.“
5.4 Ergebnisse zum Vergleich der Trainingsmaßnahmen
5.5 Explorative Analyse zu Veränderungen in der Selbst- und Fremdeinschätzung
5.6 Ergebnisse zur Bedeutung individuellen Einflussfaktoren auf die Trainingswirkung
5.6.1 Geschlecht
5.6.2 Lebenserfahrung
5.6.3 Berufserfahrung als Verhandler
5.6.4 Teilnahme an einer Verhandler-Ausbildung
6 Diskussion
6.1 Veränderungsprozesse in der Verhandlungsleistung
6.1.1 Veränderungsprozesse in der Kontrollgruppe
6.1.2 Veränderungsprozesse innerhalb der Experimentalgruppe 1: „kognitives Training S.A.F.E.“
6.1.3 Veränderungsprozesse innerhalb der Experimentalgruppe 2: „kognitiv-behaviorales Training S.A.F.E.“
6.2 Vergleich der Wirksamkeit unterschiedlicher Trainingsmaßnahmen
6.3 Individuelle Einflussfaktoren auf die Trainingswirkung
6.3.1 Veränderungen in der Selbst- und Fremdeinschätzung
6.3.2 Einfluss von Erfahrungswissen
6.4 Methodenkritik
6.5 Abschließende Betrachtung
7 Literaturverzeichnis
8 Anhang
Gaby Dubbert
Erweiterte Suizide aus forensisch-psychologischer Perspektive Eine Aktenanalyse von 31 Fällen

Gaby Dubbert, Jahrgang 1956, Diplom-Psychologin und Oberregierungsrätin a. D. 1992 bis 1994 Mitarbeiterin des Zentralen Psychologischen Dienstes der Bayerischen Polizei und Lehrbeauftragte an der Beamtenfachhochschule in Fürstenfeldbruck. 1994 bis 2008 hauptamtliche Dozentin für das Studienfach Psychologie im Fachbereich Polizei der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Schleswig-Holstein, von 2003 bis 2005 Prodekanin. Seit 2004 als Sachverständige für Prognose- und Lockerungsgutachten für die Landgerichte und Justizvollzugsanstalten in Schleswig-Holstein tätig, seit 2008 selbstständig als rechtspsychologische Gutachterin und Unternehmensberaterin zu kriminalpsychologischen Fragestellungen. Verschiedene Publikationen zu polizei- und kriminalpsychologischen Problemstellungen.
Inhalt
Inhalt
1. EINLEITUNG, GEGENSTAND UND ZIEL DER ARBEIT
2. DEFINITIONEN DES PHäNOMENS VON TöTUNGEN MIT ANSCHLUSSSUIZIDEN (ERWEITERTE SUIZIDE) UND DAMIT ZUSAMMENHäNGENDE PROBLEME IHRER ERFASSUNG
3. THEORETISCHER HINTERGRUND
3.1 Stand der Forschung und Studienlage
3.2 Theoretische Erklärungsansätze zur Selbst- und Fremdaggression (Suizidalität und Tötungsmotive) unter psychoanalytischen, sozialpsychologischen, kognitiven und forensischen Aspekten
3.2.1 Suizidale Krisen: In den Tunnel der kognitiven Einengung des präsuizidalen Syndroms
3.2.2 Psychodynamische Aspekte: Die destruktive Seite depressiver und narzisstischer Verarbeitungsmodi
3.2.3 Tatrelevante Persönlichkeitsdefizite unter der Betrachtung konfliktdynamischer und struktureller Aspekte
3.2.4 EWS im Zusammenhang mit belastenden Lebensereignissen und dysfunktionalen Bewältigungsmustern
3.2.5 Bindungstheoretische Aspekte als Mitursache für die Entwicklung partnerschaftlicher Krisen und Gewalt
3.2.6 Tötungsdelikte unter motivationalen, kognitiven und attributionstheoretischen Aspekten
3.2.7 Selbstwertschutz, psychologische Reaktanz und der Verlust von Kontrolle
3.2.8 Der Einfluss von Substanzmissbrauch auf tatrelevante Enthemmung und kognitive Verzerrungen und die Schwierigkeiten forensischer Bewertungen
3.2.9 Psychische Störungen im Kontext von Suizidalität und Tötungsdelinquenz
3.2.10 Frauen als Täterinnen und die Tötung von Kindern
3.2.11 Affekte im Kontext von Tötungsdelikten – „Crimes of Passion“?
3.2.12 Risiko- und Schutzfaktoren im Zusammenhang mit der Vorhersage von Gewalttaten
4. METHODISCHES VORGEHEN
4.1 Dokumentenanalyse
4.2 Qualitative Inhaltsanalyse
5. BESCHREIBUNG DER STICHPROBE UND FALLDARSTELLUNGEN
5.1 Die gesamte Stichprobe
5.2 Erweiterte Suizide im sozialen Nahraum (Partnerschaft und Familie), überwiegend im Kontext von „Trennungskrisen“ und finanziellen Problemen
5.2.1 Fall 1: „Wenn du diesen Brief liest, ist alles vorbei. Wahrscheinlich wird es groß in der Zeitung stehen.“
5.2.2 Fall 2: „Die Olle ist dot!“
5.2.3 Fall 3: Porsche und schöne Frauen: „Traumfrau gefunden“
5.2.4 Fall 4: Cholerisch? Trennung: Jäger erschießt Ehefrau
5.2.5 Fall 5: „Komm raus, ich hab‘ deine Mutter erschossen!“
5.2.6 Fall 6: „Ein Mensch, der nicht allein sein kann, unselbstständig und von anderen abhängig.“ Mann tötet in acht Jahren zwei Frauen
5.2.7 Fall 7: Kein Geld mehr für die Schönheits- OP. Maniforme Entwicklung?
5.2.8 Fall 8: „Hallo Süße, ich weiß nicht, inwiefern du Verständnis dafür hast…“ Vater erwürgt Sohn
5.2.9 Fall 19: Schulden. Täter erschießt Ehefrau und Hund
5.2.10 Fall 20: Kokain- Milieu- Drohende Zwangsräumung
5.2.11 Fall 21: „Und nun werde ich diese Welt, auf der ich alles das zerstört habe, was ich je geliebt habe, von mir befreien.“ Kokain, Zwangsvollstreckung, Krise
5.2.12 Fall 22: Der Hochzeitstag ist „unser Todestag“! Eifersucht, Alkohol, Waffen
5.2.13 Fall 23: „Es tut mir leid! In Liebe und Dankbarkeit.“ Häusliche Gewalt, Eifersucht, Alkohol und Drogen
5.2.14 Fall 24: „Die Welt wird mich nicht mehr erleben“. Eifersucht, zwei Flaschen Rum und Beruhigungsmittel. Die Ehefrau überlebt und ist querschnittgelähmt
5.2.15 Fall 25: „Das nehme ich dir nicht ab!“ Eifersuchtswahn, Schulden, Alkohol. Der Täter überlebt
5.3 Erweiterte Suizide im Bekanntenkreis (Nachbar, Arzt, Vermieter, Arbeitgeber)
5.3.1 Fall 9: Immer ärger mit dem Nachbarn
5.3.2 Fall 10: Falsche Diagnose?
5.3.3 Fall 26: „Alt und schwach und ohne Energie und zu krank zum Sterben.“
5.3.4 Fall 27: Zu wenig Lohn? Arbeitgeber erschossen!
5.4 Erweiterte Suizide in höherem Lebensalter vor dem Hintergrund schwerwiegender Erkrankungen mindestens eines Beteiligten
5.4.1 Fall 11: „Sie hat Depressionen seit 40 Jahren.“
5.4.2 Fall 12: Frau schwer krank- Täter bizarr- Doppelsuizid?
5.4.3 Fall 13: Pflegefall- Alzheimer: „Wenn gar nichts mehr geht.“
5.4.4 Fall 28: „Mit der Pflege seiner Frau überfordert“. Täter im Vorruhestand
5.4.5 Fall 29: Auf keinen Fall ins Pflegeheim! Ehepaar atypisch erhängt
5.4.6 Fall 30: „Wir haben euch sehr lieb und grüßen für ewig.“ Krebsdiagnose
5.5 Erweiterte Suizide, Verdacht einer akuten Psychose
5.5.1 Fall 14: „Ein Kind zum Verwöhnen“. Tochter tot, Mutter überlebt
5.5.2 Fall 15: „Von Kameras verfolgt“!
5.5.3 Fall 16: „Der eine kämpft gegen den anderen in meinem Körper!“ Mutter ersticht zwei Kinder, sie überlebt
5.5.4 Fall 17: „Ich bin ein Versager!“ Sohn erwürgt Mutter mit einem Schal
5.5.5 Fall 18: „Die überlass ich doch nicht dem!“ Tochter vergiftet, Mutter erhängt
5.5.6 Fall 31: „Who wants to live forever?” Schulden. Enkel erschießt Großmutter
5.6. Bezug zu den Fragestellungen und zum methodischen Vorgehen
6. DISKUSSION
6.1 Tätercharakteristika und Risikofaktoren im Kontext von EWS im sozialen Nahraum zum Nachteil von Partnerinnen und Familienangehörigen („Trennungskrise“)
6.1.1 EWS zum Nachteil von Partnerinnen vor dem Hintergrund finanzieller Probleme
6.1.2 Die Tötung eines Kindes und ein untauglicher Suizidversuch im Kontext einer Trennungskrise vor dem Hintergrund eines unsicher-ambivalenten Bindungsmusters
6.2 Tätercharakteristika und Risikofaktoren im Kontext von EWS zum Nachteil von Personen aus dem weiteren sozialen Umfeld („Rache“)
6.3 Tätercharakteristika und Risikofaktoren im Kontext von EWS im Zusammenhang mit schwerwiegenden Erkrankungen und im höheren Lebensalter („Bilanz“)
6.4 Tätercharakteristika und Risikofaktoren im Kontext von EWS in psychotischen oder psychosenahen Zuständen („Psychotische Störung“)
6.5 Exkurs: Misslungene Suizidversuche nach Tötungen und die Folgen
7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
8. LITERATURVERZEICHNIS
9. ANHANG
Max Hermanutz
Polizeiliches Auftreten - Respekt und Gewalt Eine empirische Untersuchung zum Einfluss verbaler Kommunikation und äußerem Erscheinungsbild von Polizeibeamten auf die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
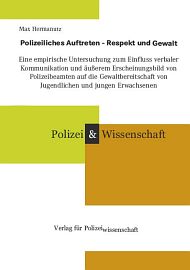
Inhalt
DANK
1 EINLEITUNG
1.1 KOMMUNIKATION ZWISCHEN BüRGERN UND POLIZEI
1.1.1 BüRGER BEWERTEN UMGANGSFORMEN VON POLIZEIBEAMTEN
1.1.2 POLIZEIBEAMTE UND PROVOKATIONEN
1.2 äUßERES ERSCHEINUNGSBILD
1.2.1 AUTORITäTSSYMBOL KLEIDUNG
1.2.2 URTEIL ZUM äUßEREN ERSCHEINUNGSBILD VON POLIZEIBEAMTEN
1.3 ZIEL DES FORSCHUNGSPROJEKTES
2 METHODE
2.1 STICHPROBE
2.1.1 BESCHREIBUNG DER EINZELNEN GRUPPEN DER STICHPROBE
2.1.2 ALTER DER BEWERTENDEN PERSONEN
2.1.3 GESCHLECHT DER PROBANDEN
2.2 UNTERSUCHUNGSDESIGN
2.3 ERSTELLUNG DER VIDEOS
2.3.1 SITUATION: RUHESTöRUNG IM JUGENDZENTRUM
2.3.2 KOMMUNIKATION: JUGENDLICHER IM JUGENDZENTRUM
2.4 DEFINITIONEN DER VERSUCHSBEDINGUNGEN
2.4.1 VERBALE KOMMUNIKATION
2.4.2 äUßERES ERSCHEINUNGSBILD
2.9 BEWERTUNGSBOGEN FüR DIE STUDIE
2.9.2 KORRELATIONEN ZWISCHEN DEN SUMMENWERTEN
2.9.3 UMCODIERUNG DER NEGATIV GEPOLTEN ITEMS
2.9.4 SUMMENBILDUNG VON DREI SUBSKALEN
2.9.5 DURCHFüHRUNG
2.9.6 ZUSATZAUSWERTUNGEN DER EINZELVIDEOS
2.10 AUSWERTUNG DER DATEN
2.11 HYPOTHESEN
3 ERGEBNISSE
3.3 ANOVA 4 VERSUCHSBEDINGUNGEN – UNIFORM, 8 GRUPPEN
3.4 ANOVA 6 VERSUCHSBEDINGUNGEN MIT POLOSHIRT, 8 GRUPPEN
3.5 NACHTESTS ZWISCHEN EINZELNEN VERSUCHSBEDINGUNGEN
3.6 EFFEKTSTäRKEN
3.7 ANOVA FüR DIE EINZELNEN ACHT STICHPROBEN
3.7.1 AUSWERTUNG 7 STICHPROBEN - OHNE POLIZEIBEAMTE
3.7.2 AUSWERTUNG DER STICHPROBE WERKREALSCHULE
3.7.3 AUSWERTUNG DER STICHPROBE 112 GYMNASIASTEN
3.7.4 AUSWERTUNG DER STICHPROBE 66 POLIZEIBEAMTE
3.7.5 AUSWERTUNG DER KONTROLLGRUPPE (N = 16)
3.7.6 AUSWERTUNG DER STICHPROBE 490 BERUFSSCHüLER
3.7.7 AUSWERTUNG DER STICHPROBE JUGENDSTRAFANSTALT (N = 19)
3.7.8 AUSWERTUNG DER STICHPROBE 20 FACHINFORMATIKER
3.7.9 AUSWERTUNG DER STICHPROBE BERUFSVORBEREITUNGSJAHR (N = 38)
3.8 NONVERBALE KOMMUNIKATION VON KONTROLL- UND SICHERUNGSBEAMTEN
4 DISKUSSION
4.1 WECHSELWIRKUNG: VERBALE KOMMUNIKATION UND äUßERES ERSCHEINUNGSBILD
4.1.1 STRESSREAKTIONEN, AUFMERKSAMKEIT, ROLLENERWARTUNG
4.2 VERBALE KOMMUNIKATION
4.3 äUßERES ERSCHEINUNGSBILD
4.3.1 POLOSHIRT
4.4 GRUPPENSPEZIFISCHE WAHRNEHMUNGEN
4.5 NONVERBALE KOMMUNIKATION DER VIDEOPERSONEN
4.6 AUS- UND FORTBILDUNG
4.7 FAZIT
5 ZUSAMMENFASSUNG
6 LITERATURVERZEICHNIS
AUTOR
ANHANG 1 URSPRüNGLICHER BEWERTUNGSBOGEN MIT 58 ITEMS
ANHANG 2 BEWERTUNGSBOGEN MIT 10 ITEMS
ANHANG 3 RATINGBOGEN EXPERTEN
Guido Baumgardt & Joachim Burgheim
Tödliche Verkehrsunfälle - Eine vergleichende Studie zu leichten Sachschadensunfällen in Nordrhein-Westfalen

Diesen zentralen Fragestellungen versucht sich die vorliegende Untersuchung von 445 tödlichen Verkehrsunfällen im Vergleich zu 405 Sachschadensunfällen aus Nordrhein-Westfalen anzunähern. Es werden die Unfallverläufe und die Delinquenz der Unfallverursacher sowohl von tödlichen Verkehrsunfällen, als auch von leichten Sachschadensunfällen miteinander verglichen…
Inhalt
Inhalt
1 ALLGEMEINE EINFüHRUNG
1.1 Verkehrslage
1.2 Tödliche Verkehrsunfälle
1.2.1 Suizid
1.2.2 Dunkelziffer
1.2.3 Internistischer Notfall
1.2.4 ärztlicher Behandlungsfehler
2 LITERATURüBERBLICK
2.1 Die Täterpersönlichkeit
2.2 Straßenverkehrsdelinquenz als Hinweis auf eine Unfallneigung
2.3 Allgemein kriminelle Handlungen
2.4 Persönlichkeitspsychologische Ansätze
2.4.1 Sensation Seeking
2.4.2 „Driving Anger“ und Aggressivität
2.4.3 Die „Big Five“
2.4.4 Persönlichkeitstypen
2.5 Verursacher schwerer Verkehrsunfälle
2.6 Die Rolle des Alkohols
2.7 Soziale und demographische Einflussgrößen
2.8 Weitere situative und personenbezogene Einflussgrößen
2.8.1 Geschlecht und Alter
2.8.2 Fahrbahnbeschaffenheit, Wetter und Jahreszeit
2.8.3 Motorradunfälle
2.8.4 Straßenrennen
3 DIE VORLIEGENDE UNTERSUCHUNG
3.1 Zielsetzung und Problemstellung
3.2 Methodik der Datenerhebung
3.2.1 Einführung
3.2.2 Vergleichsgruppe
3.2.3 Datenquellen
3.2.4 Datenerhebung und -schutz:
3.2.5 Rücklaufquoten
4 AUSWERTUNG
4.1 Die Daten aus der Verkehrsunfallanzeige (VU)
4.1.1 Soziobiographische Merkmale
4.1.2 Merkmale des Unfallgeschehens
4.1.3 Unfalltypen und Unfallursachen
4.2 Die Daten aus den Kriminalakten (KA)
4.3 Die Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA)
4.3.1 Eintragungen wegen Ordnungswidrigkeiten
4.3.2 Eintragungen wegen Straftaten
4.3.3 Eingetragene Fahrerlaubnisentzüge
4.4 Besondere Fragestellungen
4.4.1 Fahren ohne Fahrerlaubnis und Alkoholkonsum in der Gruppe 1
4.4.2 Fahrer motorisierter Zweiräder
4.4.3 Wiederholungstäter
4.4.4 Straßenrennen
4.5 Multivariate Analysen
4.5.1 Clusteranalytische Berechnungen
5 DISKUSSION DER BEFUNDE
5.1 Allgemeine Einzelmerkmale
5.2 Risikomerkmale
5.3 Die Ergebnisse der Clusteranalysen
5.3.1 Die Gesamtgruppe
5.3.2 Die Verursacher tödlicher Unfälle
5.4 Empfehlungen für die Polizei in NRW
5.4.1 Informationssteuerung innerhalb der Polizei und zur Fahrerlaubnisbehörde
5.4.2 Verkehrsüberwachung
5.4.3 Verkehrssicherheitsberatung
6 LITERATURVERZEICHNIS
7 ANGABEN ZU DEN AUTOREN
Nicolaus Held
Rockertum: Kriminelle Vereinigungen oder nur freiheitsliebende Motorradvereine? Sind in Biker Zeitschriften manifeste oder latente Hinweise auf kriminelles Verhalten innerhalb der Subkultur der Rocker erkennbar?
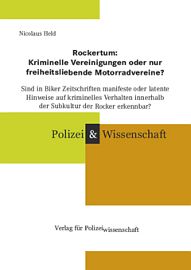
Inhalt
Inhalt
1 Thematische Einführung
1.1 Geschichtliche Entwicklung der Rocker
1.2 Aktuelle Entwicklungen in Deutschland
2 Stand der Forschung
2.1 Rocker in der Bundesrepublik – Eine Subkultur zwischen Jugendprotest und Traditionsbildung (Simon 1989)
2.2 Rocker im Spannungsfeld zwischen Clubinteressen und Gesellschaftsnormen (Opitz 1990)
2.3 Die Subkultur der Rocker (Cremer 1992)
2.4 Analyse der Zeitschrift Bikers News durch Günter Cremer
3 Untersuchungsfrage
3.1 Die Zeitschrift Bikers News
3.1.1 Kurzportrait
3.1.2 Geschichtliche Entwicklung von Bikers News
3.1.3 Selbstverständnis von Bikers News
3.1.4 Bikers News im Vergleich zu anderen Medien
3.1.5 Geeignetheit von Bikers News für die Untersuchung
3.2 Anlass der empirischen Untersuchung
4 Die empirische Untersuchung – Methode und Vorgehensweise
4.1 Die Inhaltsanalyse
4.2 Auswahl der Hefte
4.3 Untersuchte Rubriken
4.3.1 Checkpoint
4.3.2 Leserbriefe
4.3.3 Aus der Presse
4.3.4 Jail Mail
4.3.5 Clubnachrichen
4.3.6 Aus der Szene
4.3.7 OMCG‘s
4.3.8 Treffen/Clubberichte
4.3.9 Stil/Historisches
4.4 Gliederung der Untersuchungsfragen/Auswerteraster
4.4.1 Selbstbild der Rocker
4.4.2 Selbstdarstellung
4.4.3 Antizipiertes Fremdbild
4.4.4 Der „Staatsgewalt“ zugeteilte Rolle
4.4.5 Darstellung von Maßnahmen der „Staatsgewalt“
4.4.6 Hinweise auf bereits begangene Rechtsbrüche
4.4.7 Hinweise auf geplante/intendierte Rechtsbrüche
4.4.8 Hinweise und Indikatoren auf kriminelle Strukturen
4.5 Extraktion
5 Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse
5.1 Ziel und Aufbau der Ergebnisdarstellung
5.2 Ergebnisse zu den einzelnen Teilfragen
5.2.1 Selbstbild der Rocker
5.2.2 Selbstdarstellung
5.2.3 Antizipiertes Fremdbild
5.2.4 Der „Staatsgewalt“ zugeteilte Rolle
5.2.5 Darstellung von Maßnahmen der „Staatsgewalt“
5.2.6 Hinweise auf bereits begangene Rechtsbrüche
5.2.7 Hinweise auf geplante/intendierte Rechtsbrüche
5.2.8 Hinweise und Indikatoren auf kriminelle Strukturen
5.2.9 Jail Mail
5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
5.4 Bedeutung für die polizeiliche Arbeit
6 Schlussbetrachtung
LITERATURVERZEICHNIS
QUELLEN
ANLAGEN
Silvia Gubi-Kelm
Der richtige Ton – Welchen Einfluss hat die Intonation eines Befragers auf den Aussageinhalt eines Befragten?

In der hier vorliegenden Arbeit werden die Grundlagen der Intonation in der gesprochenen Sprache beschrieben und die Auswirkungen verschiedener Intonationsverläufe auf den Inhalt einer Aussage untersucht. Das zentrale Ergebnis dieser Arbeit ist, dass die Intonation der in einem Gespräch dargebotenen verbalen Informationen sowohl einen Einfluss auf die Suggestibilität als auch auf die Informationsaufnahme und -verarbeitung hat. Die Bedeutung dieses Ergebnisses wird für die forensische Psychologie, aber auch für weitere Anwendungsfelder der psychologischen Diagnostik aufgezeigt.
Inhalt
Inhalt:
Einleitung
Kapitel 1: Psychologischer Hintergrund
1.1 Suggestion, Suggestivität, (Interrogative) Suggestibilität: Terminologische Abgrenzungen
1.2 Interrogative Suggestibilität und benachbarte Phänomene: Terminologische Abgrenzungen
1.3 Zentrale Paradigmen der interrogativen Suggestionsforschung
1.3.1 Das Paradigma des Falschinformationseffektes
1.3.2 Das Paradigma der Pseudoerinnerungen
1.3.3 Das Paradigma suggestiver Fragen
1.4 Zentrale Befunde der interrogativen Suggestionsforschung
1.4.1 Prämissen auf Seiten des Befragers
1.4.2 Formen der suggestiven Beeinflussung
1.4.3 Prämissen auf Seiten des Befragten
1.5 Die Gudjonsson Suggestibility Scales
1.6 Das Modell der Interrogativen Suggestibilität
1.7 Resümee Kapitel 1: Psychologischer Hintergrund und Ausblick
Kapitel 2: Linguistischer Hintergrund
2.1 Intonation: Definitionen
2.2 Beschreibungskategorien der Intonation
2.2.1 Aspekte der Produktion
2.2.2 Aspekte des akustischen Signals
2.2.3 Aspekte der Perzeption
2.3 Prototypische Intonationsmuster
2.3.1 Formen und Funktionen prototypischer Intonationsmuster
2.3.2 Konkatenationen prototypischer Intonationsmuster
2.4 Funktionen der Intonation
2.4.1 Linguistische Funktionen der Intonation
2.4.2 Paralinguistische Funktionen der Intonation
2.5 Resümee Kapitel 2: Linguistischer Hintergrund und Ausblick
Kapitel 3: Studie I
3.1 Fragestellung
3.2 Inhaltliche Hypothesen
3.3 Versuchsdesign
3.3.1 Unabhängige Variablen
3.3.2 Abhängige Variablen
3.3.3 Störvariablen
3.4 Stimulusmaterial und Operationalisierungen
3.4.1 Deutsche Version der forensischen Gudjonsson Suggestibility Scale
3.4.2 Unabhängige Variablen
3.4.3 Abhängige Variablen
3.4.4 Störvariablen
3.5 Beschreibung der Stichprobe
3.6 Beschreibung des Studienablaufs
3.7 Allgemeine Hinweise zur Ergebnisdarstellung
3.8 Voranalysen
3.8.1 Interraterreliabilitäten
3.8.2 Skalen- und Itemkennwerte
3.9 Hypothesengeleitete Auswertung
3.9.1 PH-A: Finale Kontur der Fragesätze
3.9.2 PH-B: Akzentuierung von Details der Fragesätze
3.9.3 PH-C: Kombination von finaler Kontur und Akzentuierung von Details der Fragesätze
3.10 Diskussion
3.10.1 Voranalysen
3.10.2 PH-A: Finale Kontur der Fragesätze
3.10.3 PH-B: Akzentuierung von Details der Fragesätze
3.10.4 PH-C: Kombination von finaler Kontur und Akzentuierung von Details der Fragesätze
3.10.5 Resümee und kritische Würdigung der Ergebnisse
Kapitel 4: Studie II
4.1 Fragestellung
4.2 Inhaltliche Hypothesen
4.3 Versuchsdesign
4.3.1 Unabhängige Variablen für Versuchsdesign A und B
4.3.2 Abhängige Variable für Versuchsdesign A und B
4.3.3 Störvariablen für Versuchsdesign A und B
4.4 Operationalisierungen
4.4.1 Unabhängige Variable für Versuchsdesign A
4.4.2 Unabhängige Variable für Versuchsdesign B
4.4.3 Abhängige Variable für Versuchsdesign A
4.4.4 Abhängige Variablen für Versuchsdesign B
4.4.5 Störvariablen für Versuchsdesign A und B
4.5 Beschreibung der Stichprobe
4.6 Beschreibung des Studienablaufs
4.7 Allgemeine Hinweise zur Ergebnisdarstellung
4.8 Voranalysen
4.8.1 Interraterreliabilitäten für Versuchsdesign A und B
4.8.2 Skalen- und Itemkennwerte für Versuchsdesign A und B
4.9 Hypothesengeleitete Auswertung
4.9.1 PH-A: Sprechstil
3.9.2 PH-B: Zentralität hervorgehobener Details
4.10 Diskussion
4.10.1 Voranalysen
4.10.2 PH-A: Sprechstil
4.10.3 PH-B: Zentralität hervorgehobener Details
4.10.5 Resümee und kritische Würdigung der Ergebnisse
Kapitel 5: Abschließende Diskussion
5.1 Implikationen für Theorie und Praxis
5.2 Der richtige Ton
Literatur
Anhang