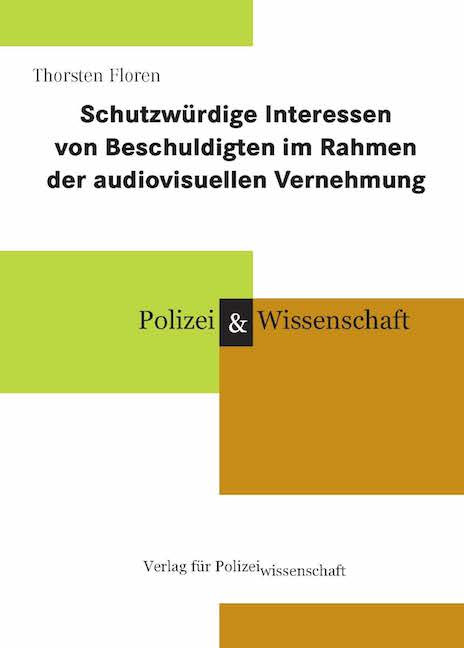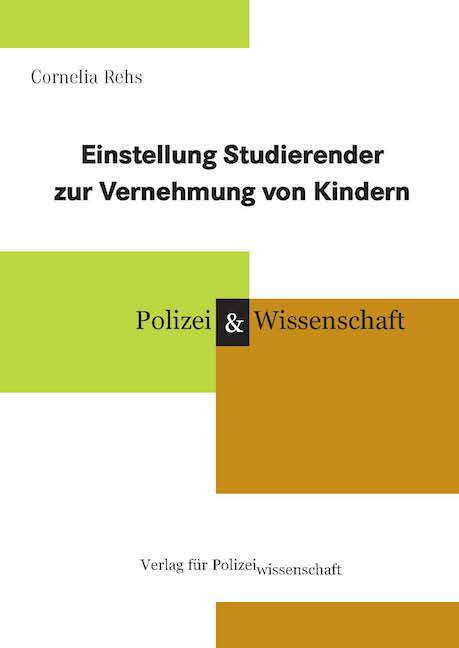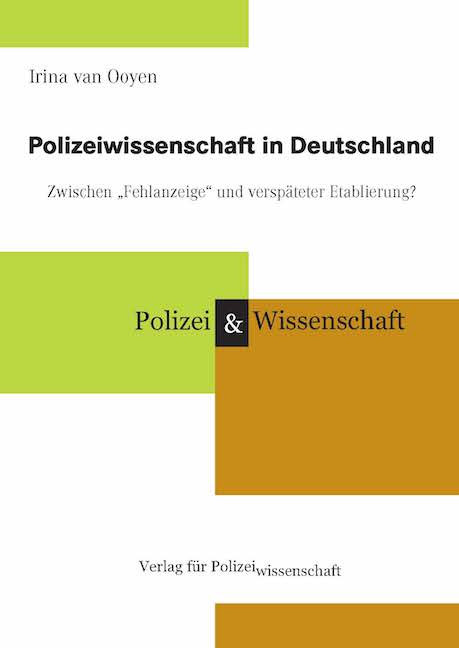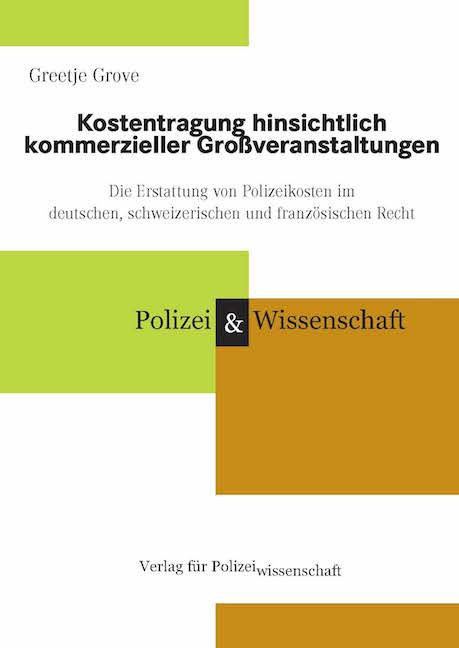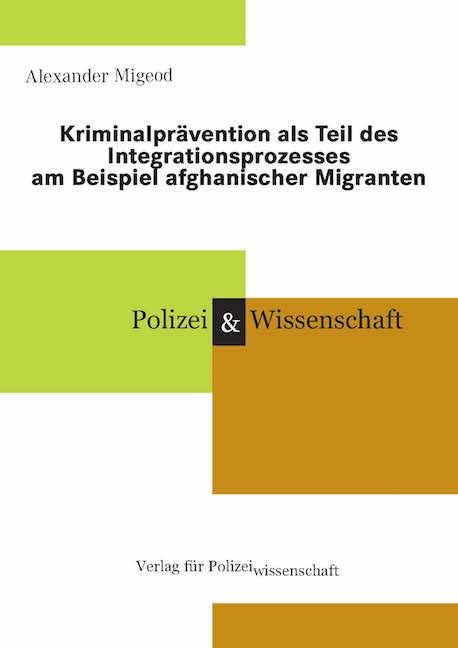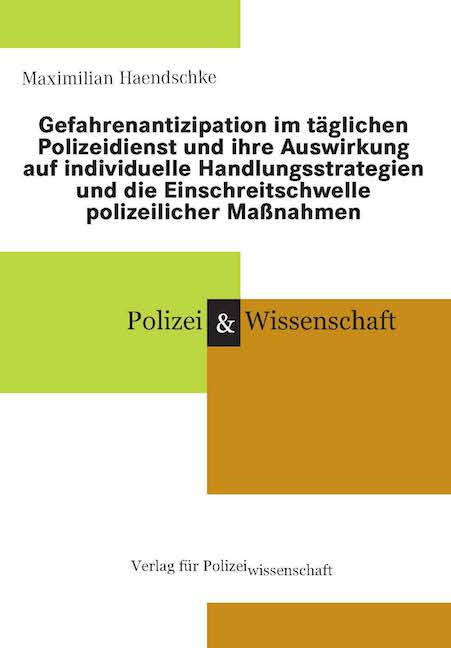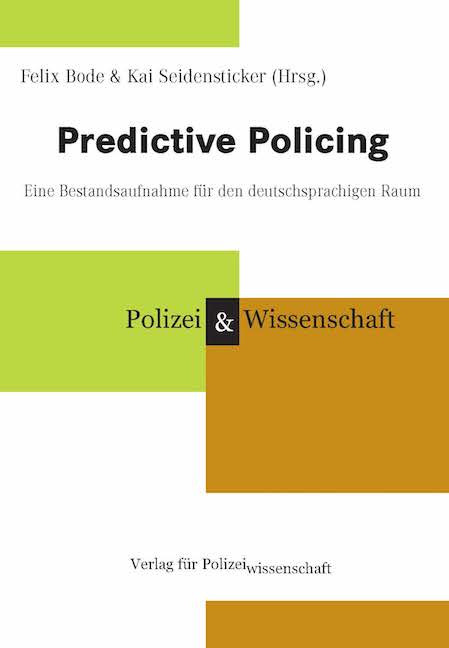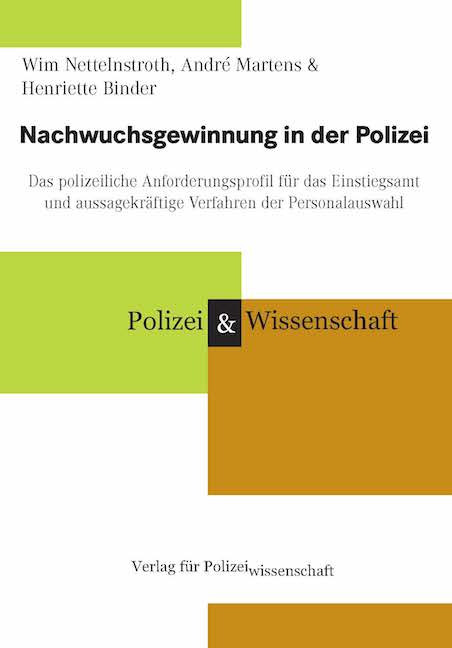Thorsten Floren
Schutzwürdige Interessen von Beschuldigten im Rahmen der audiovisuellen Vernehmung Erkennen von eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder einer schwerwiegenden seelischen Störung bei einem Beschuldigten als Herausforderung für den Vernehmungsbeamten -
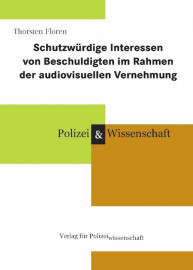
Inhalt
Inhalt:
1. Einführung
1.1. Forschungsfrage
1.2. Zielsetzung
1.3. Methodik
2. Gesetzesänderung des § 136 StPO
2.1. Expertenkommission zur Gesetzesänderung des § 136 StPO
2.2. Vor- und Nachteile der audiovisuellen Vernehmung aus Sicht des Gesetzgebers
2.3. Beschuldigtenvernehmung
2.3.1. Zielsetzung und Möglichkeiten einer Beschuldigtenvernehmung
2.3.2. Vorbereitung der Beschuldigtenvernehmung
2.3.3. Vorgaben bei der Polizei in Bezug auf das Erkennen von eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder schwerwiegenden seelischen Störungen
2.4. Die Entwicklung der Videovernehmung in Bild und Ton
2.5. Chancen, Hindernisse und Vorgaben zu einer audiovisuellen Vernehmung
3. Einordnung der Begrifflichkeiten: Eingeschränkte geistige Fähigkeiten und schwerwiegende seelische Störung
3.1. Häufigkeit: Verminderte Schuldfähigkeit/Schuldunfähigkeit
3.2. Definition: Eingeschränkte geistige Fähigkeiten
3.3. Definition: Schwerwiegende seelische Störung
3.4. Anwendung der Merkmale des § 20 StGB
3.5. Befunderhebung auf Grund der Merkmale des § 20 StGB durch den Gutachter im Vergleich zur Vernehmungsperson
4. Krankhafte seelische Störung
4.1. Schizophrene Psychosen
4.2. Affektive Psychosen
4.3. Hirnorganische und körperlich verursachte Störungen
4.4. Psychopathologische Störungen durch die Einwirkung von psychotropen Substanzen
4.4.1. Psychotrope Substanz: Alkohol
4.4.2. Psychotrope Substanz: Illegale Drogen und Medikamente
5. Tiefgreifende Bewusstseinsstörungen
6. Schwachsinn
7. Schwere andere seelische Abartigkeiten
7.1. Neurotische Störung
7.1.1. Affektive Störungen (Anpassungsstörungen)
7.1.2. Abnormale Gewohnheiten (Spielen, Stehlen, Feuerlegen, etc.)
7.2. Persönlichkeitsstörungen
7.3. Sexuelle Deviationen
7.4. Abhängigkeitserkrankungen
7.4.1. Alkohol
7.4.2. Illegale Drogen, Medikamente
8. Begriffsverortung: Eingeschränkte geistige Fähigkeiten und schwerwiegende seelische Störung
9. Empirische Befragung
9.1. Empirische Sozialforschung
9.2. Überblick über die gewählte Forschungsmethode
9.3. Die Methode der schriftlichen Befragung
9.3.1. Phase 1 der Befragung (Formulierung und Präzisierung der Forschungsfrage)
9.3.2. Phase 2 der Befragung (Planung und Vorbereitung der Erhebung)
9.3.3. Phase 3 der Befragung (Datenerhebung)
9.3.4. Phase 4 der Befragung (Datenauswertung)
9.3.5. Phase 5 der Befragung (Berichterstattung)
10. Prüfungsschema für Vernehmungspersonen
11. Handlungsempfehlung für Vernehmungspersonen
12. Vergleich Anforderungen an Vernehmungspersonen/Ausbildungsstand von PVB am Beispiel der Polizei NRW
13. Offene Fragen
14. Zusammenfassung
15. Literaturverzeichnis
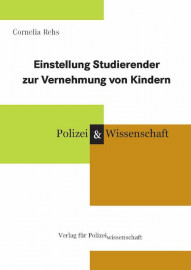
Inhalt
Inhalt:
1. Einleitung
1.1. Problemstellung und Thematische Abgrenzung
1.2. Einstellung der Studierenden zur Vernehmung von Kindern
1.3. Nonverbales Verhalten
1.4. Trauma
1.5. Zielsetzung und Hypothesen
2. Methode
2.1. Versuchspersonen
2.2. Rekrutierung
2.3. Situation der Befragung
2.4. Methodisches Vorgehen
2.5. Gütekriterien der Inhaltsanalyse
3. Ergebnisse
3.1. Vorgehen bei der Auswertung
3.2. Beschreibung des Kategoriensystems
4. Diskussion
4.1. Reflexion der ersten Hypothese
4.2. Reflexion der zweiten Hypothese
4.3. Reflexion der dritten Hypothese
4.4. Limitierungen der Studie und Ausblick für die Forschung
4.5. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
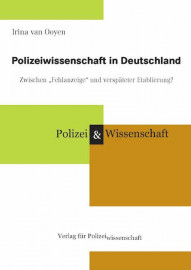
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
2 Wissenschaftsbegriff in den Sozialwissenschaften
2.1 Die Bedeutung des zweiten Positivismusstreits
2.2 „Gesellschaftliche Objektivität“: Adorno
2.3 Kritischer Rationalismus: Popper
2.4 Heutige Relevanz für das Verständnis von Wissenschaft
2.4.1 Allgemein
2.4.2 Bedeutung speziell für eine Polizeiwissenschaft
3 Die Policey-Wissenschaft und Police Science
3.1 Policey-Wissenschaft in Deutschland
3.2 Herausbildung des modernen Polizeibegriffes
3.3 Definition
3.4 Akademische Etablierung in anderen Ländern (USA und Großbritannien)
4 Polizeiwissenschaft in der Bundesrepublik
4.1 Ansätze einer Polizeiwissenschaft als Sozialwissenschaft
4.2 Paradigmenwechsel und neue Punitivität
4.3 Die „neue“ Polizeiwissenschaft: Bestandsaufnahme
4.3.1 Verspätete Hochschulausbildung für den Polizeidienst und „Roll-Back“
4.3.2 Netzwerke - Wissenschaft als sozialer Prozess im Sinne Poppers
4.3.2.1 Fachzeitschriften
4.3.2.2 Verlage
4.3.2.3 Plattformen (zur Empirischen Polizeiforschung)
4.3.3 Krise der Polizeiwissenschaft? Die Bochumer Tagung 2013
4.4 Zwischenergebnis und Bewertung
5 Ursachen der „verspäteten“ und unzureichenden Polizeiwissenschaft
5.1 Die politische Kultur des „Obrigkeitsstaates“
5.2 Juristenmonopol in der Verwaltung und Dominanz der Rechtswissenschaften
5.3 „Cop-Culture“
5.4 Dominanz der Praxis und institutionelle Abschottung
5.5 Der interne Streit um das Fach
6 Zur Bedeutung einer Polizeiwissenschaft
6.1 Diversity Management bei der Polizei
6.1.1 Frauen
6.1.2 Migranten/-innen
6.2 Fremdenfeindlichkeit
7 Zusammenfassung
Greetje Grove
Kostentragung hinsichtlich kommerzieller Großveranstaltungen Die Erstattung von Polizeikosten im deutschen, schweizerischen und französischen Recht
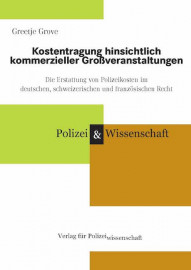
Hintergrund der Frage ist der Kostenbescheid des Landes Bremen gegenüber der Deutschen Fußball Liga für den Polizeieinsatz beim Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den Hamburger SV am 19.04.2015. In der ersten Instanz vor dem VG Bremen bekam die Deutsche Fußball Liga noch Recht und das Gericht sah den Erlassenen Verwaltungsakt als rechtswidrig an. Sowohl das OVG Bremen als auch das Bundes-verwaltungsgericht hingegen haben die bremische Regelung für rechtmäßig und mit dem Verfassungsrecht vereinbar erklärt.
Das vorliegende Werk setzt sich mit den Anforderungen an Tatbestandsvoraussetzungen für eine recht- und verfassungsmäßige Rechtsgrundlage auseinander und thematisiert dabei die obige Regelung. Zudem werden die Kostengesetze der weiteren 15 Länder dahingehend untersucht, ob nicht unter den aktuell in Kraft befindlichen Regelungen schon Normen bestehen, mit denen die Kosten für Polizeieinsätze zur Sicherung kommerzieller Großveranstaltungen von den Veranstaltern zurück gefordert werden können.
Abschließend wird das Kostenrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Frankreich untersucht und analysiert, wie Kostenregelungen für kommerzielle Großveranstaltungen dort ausgestaltet sind. Diskutiert wird dabei, ob die dort vorhandenen Ansätze eine Vorbildfunktion für eine einheitliche Regelung in Deutschland haben können.
Inhalt
Inhalts:
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Verzeichnis über zitierte Gesetze und Verordnungen
A. Einführung
I. Problemaufriss
II. Ziel der Untersuchung
III. Thematische Schwerpunkte
IV. Stand der Forschung
V. Praktische Relevanz des Themas: Kosten im Zusammenhang mit Polizeieinsätzen
VI. Politische Einflüsse
B. Die Möglichkeit der Kostenerhebung: Begriffsbestimmung, rechtsdogmatische Analyse, Rechtsvergleich
I. Kapitel 1: Kosten bei kommerziellen Großveranstaltungen, Definition und Einordnung in den rechtlichen Kontext
II. Kapitel 2: Einsatz der Bundes- und Landespolizei
III. Kapitel 3: Die Inanspruchnahme von Veranstaltern nach alter Rechtslage
IV. Kapitel 4: Die Inanspruchnahme von Veranstaltern nach aktueller Rechtslage in Deutschland
V. Kapitel 5: Ausgestaltung einer Norm aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse
C. Fazit
I. Die verfassungsmäßige Ausgestaltung eines Kostentatbestandes
II. Die Machbarkeit einer Kostenerhebung und der rechtspolitische Einfluss
III. Ausblick
Alexander Migeod
Kriminalprävention als Teil des Integrationsprozesses am Beispiel afghanischer Migranten
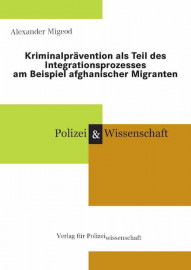
Lesenswert könnte die vorliegende Masterarbeit zum Beispiel für Kriminologen, Sozialwissenschaftler, Migrationsforscher und Psychologen sein. Auch für Personen, welche im Rahmen des Integrationsprozesses mit Afghanen oder Menschen aus dem islamisch geprägten Kulturkreis zusammenarbeiten, könnten nützliche Informationen enthalten sein.
Alexander Migeod, M.A., Dipl.-Verwaltungswirt ist derzeit als Polizeifachlehrer am Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Neustrelitz tätig. Er verfügt über eine langjährige Berufserfahrung und war an verschiedenen polizeilichen Einsätzen in muslimisch geprägten Ländern beteiligt. Unter anderem war er in den Jahren 2010, 2011 und 2012 in Afghanistan eingesetzt.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Begriffsbestimmungen
2.1.1 Kriminalprävention
2.1.2 Integration
2.2 Zielsetzungen und Dimensionen der Kriminalprävention
2.2.1 Kriminalpolitische Zielsetzung
2.2.2 Kriminologische Zielsetzung (Dimensionen)
2.2.3 Grenzen und Möglichkeiten der Kriminalprävention
2.3 Integration
2.3.1 Stand der Migrations- und Integrationsforschung
2.3.2 Integrationskurse
2.3.3 Schwerpunkte der Integration
2.3.4 Grenzen und Möglichkeiten der Integration
2.4 Kulturkonflikttheorie nach Thorsten Sellin
2.4.1 Kulturbegriff
2.4.2 unmittelbarer und mittelbarer kriminogener Kulturkonflikt
2.4.3 innerer und äußerer Kulturkonflikt
2.4.4 Grenzen und Möglichkeiten der Kulturkonflikttheorie
3 Bezugsgruppe der Afghanen
3.1 Deutsch – Afghanische Beziehungen
3.2 Migration von Afghanen nach Deutschland
3.3 Kultur der Afghanen
3.4 Afghanen in der Polizeilichen Kriminalstatistik
3.4.1 Die Polizeiliche Kriminalstatistik
3.4.2 Die Bezugsgruppe der Afghanen in der PKS
4 Bezugnahme auf die theoretischen Grundlagen
4.1 Kriminalprävention
4.1.1 Wirkung von Generalprävention und Spezialprävention
4.1.2 Wirkungen primärer, sekundärer und tertiärer Kriminalprävention
4.2 Schwerpunkte der Integration
4.3 Erklärungsansätze mit Hilfe der Kulturkonflikttheorie
5 Interventionsmöglichkeiten .........................................
5.1 kriminalpräventive Ansätze im Integrationsprozess
5.2 Handlungsalternativen
6 Schlussbetrachtung und Fazit
Literaturverzeichnis
Maximilian Haendschke
Gefahrenantizipation im täglichen Polizeidienst und ihre Auswirkung auf individuelle Handlungsstrategien und die Einschreitschwelle polizeilicher Maßnahmen
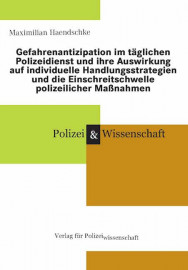
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
1.1 Polizeihandeln im öffentlichen Diskurs
1.2 Polizeihandeln zwischen Individualität und Organisationslogik
1.3 Eigene Beobachtungen im Forschungsfeld Polizei
2 Forschungsfragen und Hypothesen
2.1 Gefahrenantizipation
2.2 Vulnerabilitätsempfinden als mögliche Determinante
2.3 Gefahrenantizipation und Handlungsstrategien
2.4 Zielsetzung dieser Arbeit
3 Definitionen und theoretische Grundlagen
3.1 Zum Begriff der Gefahr
3.2 Die eigene Einschreitschwelle
4 Stand der Wissenschaft
4.1 Kriminologische Befunde
4.1.1 Dimensionen von Kriminalitätsfurcht
4.1.2 Vulnerabilität und Copingfähigkeiten
4.1.3 Methodische Erkenntnisse zur Messung von Kriminalitätsfurcht
4.2 Polizeiwissenschaftliche Befunde
4.2.1 Die Gefahrengemeinschaft
4.3 Zusammenfassung
5 Forschungsmethodik
5.1 Konzeption und Durchführung der Online-Befragung
5.2 Datenaufbereitung und Auswertung
6 Deskriptive Darstellung der erhobenen Daten
6.1 Grunddaten der Stichprobe
6.2 Personales Vulnerabilitätsempfinden
6.3 Institutionelle Vulnerabilität innerhalb der Polizei
6.4 Gefahrenantizipation im täglichen Dienst
6.5 Handlungsstrategien
6.6 Freitexteingaben
7 Thesengerichtete Analyse von Zusammenhängen
7.1 Vulnerabilität
7.2 Gefahrenantizipation
7.3 Handlungsstrategien
8 Fazit
Anlagen
Felix Bode & Kai Seidensticker (Hrsg.)
Predictive Policing Eine Bestandsaufnahme für den deutschsprachigen Raum
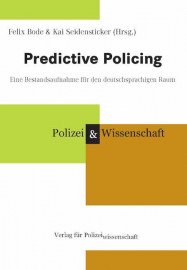
Die Begriffsbestimmung von Predictive Policing ist in Wissenschaft und Praxis zwar nicht einheitlich, sie umfasst aber grundsätzlich jegliche Form vorausschauender Polizeiarbeit. Das Spektrum der inhaltlichen Ausgestaltung ist groß, zum Beispiel ob mit täterbezogenen Prognosen gearbeitet wird oder ob raumbezogenen Prognosen erstellt werden. Die Landschaft an Umsetzungsmöglichkeiten ist im deutschsprachigen Raum entsprechend vielfältig.
Neben der verstärkten Implementierung von Predictive-Policing-Umsetzungen in den Polizeien, zeigt sich auch im wissenschaftlichen Diskurs, dass zwischenzeitlich eine Vielzahl an Arbeiten, Artikeln und Untersuchungsberichten publiziert wurde. Leider sind diese Auseinandersetzungen allesamt sehr heterogen über die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen verteilt.
Ziel dieses Sammelbandes soll es sein, im Rahmen einer Bestandsaufnahme zu Predictive Policing für den deutschsprachigen Raum, eine Wissensbündelung zu schaffen. In diesem Zusammenhang sollen bestehende Umsetzungen von verschiedenen Polizeien inhaltlich und methodisch dargestellt sowie aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen (z. B. der Soziologie, der Geografie oder den Rechtswissenschaften) positive wie negativen Auswirkungen von Predictive Policing diskutiert werden. Die Diskussionen zu Predictive Policing sind auch in Zeiten schneller technischer Veränderungen relativ stabil und ändern sich gerade mit Blick auf bestimmte Grundsatzfragen und -probleme nicht. Im Fokus stehen beispielsweise immer wieder
• methodische Aspekte des sog. Near-Repeat-Phänomens,
• die Schwierigkeiten bei der Wirkungszumessung,
• die Veränderung polizeilichen Kontrollverhaltens,
• die mögliche Stigmatisierung des Raumes oder aber
• die rechtlichen Befugnisse.
Mit diesem Sammelband sollen die wesentlichen Grundsatzfragen und -probleme so gebündelt werden, dass für den deutschsprachigen Raum ein Werk entsteht, welches auch den Leserinnen und Lesern einen umfassenden Überblick über Predictive Policing gibt. Gleichzeitig versteht sich der Sammelband als mögliche Hilfestellung bei zukünftigen kriminalpolitischen Entscheidungen, insbesondere mit Blick auf methodische, rechtliche und ethische Grenzen von Predictive Policing.
Inhalt
W. Nettelnstroth, A. Martens & H. Binder
Nachwuchsgewinnung in der Polizei: Das polizeiliche Anforderungsprofil für das Einstiegsamt und aussagekräftige Verfahren der Personalauswahl
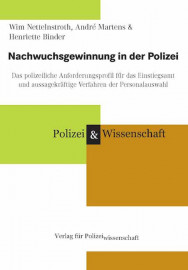
Um für die zukünftigen Aufgaben der Polizei durch einen qualifizierten Personalstamm gewappnet zu sein, werden aus polizeispezifischen empirischen Erkenntnissen heraus Empfehlungen zu folgenden Fragestellungen abgeleitet: Welche empirisch fundierten Dimensionen sollten in die Erstellung eines evidenzbasierten Anforderungsprofils für das Einstiegsamt einfließen? Welche Verfahren bzw. welche Verfahrenskombinationen prognostizieren den Ausbildungs-, Studien- und Berufserfolg am besten und welches Gewicht sollten sie im Gesamtverfahren einnehmen?