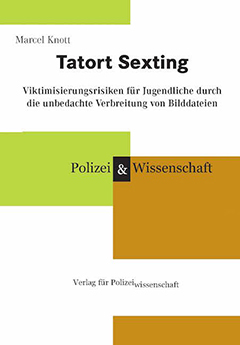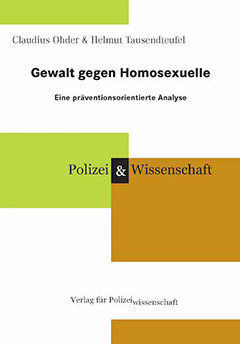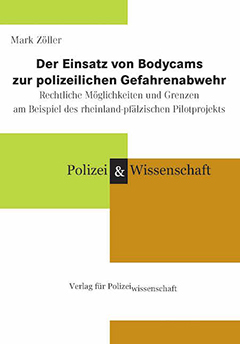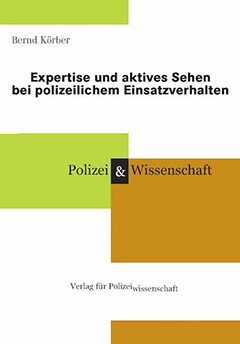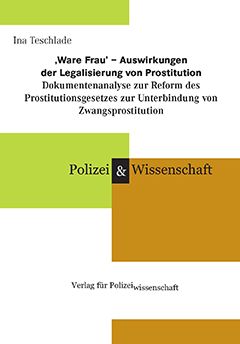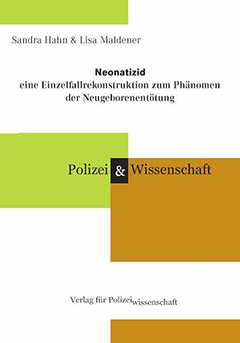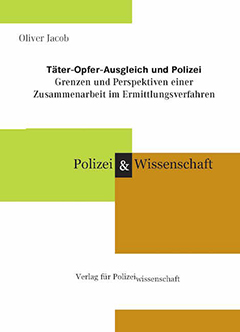Marcel Knott
Tatort Sexting Viktimisierungsrisiken für Jugendliche durch die unbedachte Verbreitung von Bilddateien
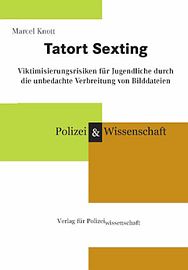
Um einen Einblick in das Phänomen zu bekommen, wurden zwischen Juni und August 2015 bundesweit an fünf Schulen zur Schaffung einer fundierten Datenbasis insgesamt 92 Schülerbefragungen durchgeführt. Darüber hinaus wird ein Einblick in den derzeitigen Forschungsstand gegeben, eine strafrechtliche Beurteilung vorgenommen und Motive, Ursachen und Gefahren beschrieben. Anhand der viktimologischen Routine Activity Theory wird erklärt, warum Jugendliche Sexting betreiben. Abschließend wurden Präventions- und Interventions-ansätze entwickelt, Hinweise zum verantwortungsvollem Austausch der Nacktaufnahmen („Safer-Sexting“) gegeben und auf die Relevanz von Sexting für die zukünftige Polizeiarbeit eingegangen.
Inhalt
Inhalt
Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Ziele der Arbeit
1.3 Aufbau der Arbeit
Entwicklung einer Arbeitsdefinition
2.1 Definition Smartphone
2.2 Definition Sexting
2.2.1 Diskussion von Sexting-Kriterien
2.2.2 Entwicklung einer zeitgerechten Sexting-Definition
2.3 Abgrenzungen zu weiteren Phänomenen
2.3.1 Cybergrooming
2.3.2 Cybermobbing
2.3.3 Cybersex
2.3.4 Sexting unter Erwachsenen
2.4 Festlegung der Arbeitsdefinition
Polizeiliche Relevanz
3.1 Rechtliche Betrachtung des Phänomens
3.1.1 Grundrechte
3.1.2 Kernstrafrecht
3.1.3 Nebenstrafrecht: Kunsturhebergesetz
3.2 Polizeiliche Erfassung von Sexting
3.2.1 Zentrale bundesweite Erfassung von Sexting
3.2.2 Dezentrale Erfassung von Sexting bei den Länderpolizeien
3.2.3 Auswertung der Hellfeld-Daten
3.3 Zusammenfassung
Literaturbasierte Phänomenanalyse
4.1 Derzeitiger Forschungsstand
4.2 Motive und Ursachen für Sexting
4.2.1 Einvernehmliches Sexting
4.2.2 Weiterleitung und Veröffentlichung von Nacktaufnahmen
4.3 Gefahren von Sexting
4.3.1 Soziale Folgen
4.3.2 Psychische Folgen
4.3.3 Physische Folgen
4.3.4 Schulische Folgen
4.3.5 Berufliche Folgen
4.3.6 Technischen Folgen
4.3.7 Erlangen von Kinder- und Jugendpornografie
4.4 Soziodemografische und sozioökonomische Merkmale
4.4.1 Alter
4.4.2 Geschlecht
4.4.3 Staatsangehörigkeit und kultureller Hintergrund
4.4.4 Bildungsstatus
4.4.5 Beziehungsverhältnis der Beteiligten
4.5 öffentliche Meinungen zum Sexting
4.5.1 Devianz-Position
4.5.2 Normalitäts-Position
4.6 Entwicklung von literaturbasierten Hypothesen
Untersuchung an Schulen
5.1 Untersuchungszugang
5.2 Vorbereitung
5.2.1 Forschungsfragen
5.2.2 Methodik und Forschungsdesign
5.2.3 Bestimmung der Zielgruppe
5.2.4 Auswahl der Schulen
5.2.5 Fragebogenkonstruktion
5.2.6 Pretest
5.2.7 Mögliche Verzerrfaktoren
5.2.8 Planung der Ergebnisauswertung
5.3 Durchführung
5.4 Auswertung
5.4.1 Auswertung der einzelnen Fragenkomplexe
5.4.2 Beantwortung der Forschungsfragen
5.4.3 überprüfung der literaturbasierten Hypothesen
5.4.4 Vergleiche mit anderen Studien
5.4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
Anwendung einer Kriminalitätstheorie
6.1 Auswahl
6.2 Definition
6.2.1 Entstehung
6.2.2 Ursprüngliches Modell
6.2.3 Modifiziertes Modell
6.2.4 Zusätzliche Elemente
6.3 Subsumtion
Präventions- und Interventionsansätze
7.1 Eltern
7.2 Schule
7.3 Beratungsstellen und Hilfsorganisationen
7.4 Polizei
7.4.1 Primäre Präventionsmaßnahmen
7.4.2 Sekundäre Präventionsmaßnahmen
7.4.3 Tertiäre Präventionsmaßnahmen
7.4.4 Interventionsansätze
7.5 Safer Sexting
Fazit
8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
8.2 Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis

Aber es gibt es eine zweite Realität: Homosexuelle werden weiterhin diskriminiert, feindselige Einstellungen sind verbreitet und kulturell verankert. Homosexuellenfeindliche An- und übergriffe sind nach wie vor Teil der Lebensrealität homosexueller Männer. Mit dem Erstarken populistischer und fundamentalistischer Strömungen deutet sich ein Absinken der Hemmschwelle für diese Gewalt an und es besteht kein Grund für die Annahme, dass sich das Problem in der Folge weiterer Emanzipationsschritte „von selbst“ lösen könnte. Gezielte präventive Maßnahmen sind daher erforderlich.
Gewaltprävention hat zwei Voraussetzung: Ein klares Bild von dem Umfang und der Struktur sowie ein gutes Verständnis der Entstehungsprozesse und Entwicklungsdynamiken ihres Gegenstandes. Die vorliegende Studie leistet hierzu einen Beitrag, indem sie das komplexe Verhältnis von homosexuellenfeindlichen Einstellungen und Gewalt gegen Homosexuelle beleuchtet. Auf der Basis von Statistiken, Akten, Fallsammlungen und Experteninterviews werden Tatsituationen herausgearbeitet, die markante Verdichtungen innerhalb des breiten Spektrums homosexuellenfeindlicher Straftaten bilden und so Möglichkeiten zur Entwicklung praxisnaher Präventionsansätze eröffnen.
Inhalt
Inhalt
Vorwort
1 Stand der Forschung zu homosexuellenfeindlicher Gewalt
1.1 Konzeptualisierungen von Homosexuellenfeindlichkeit
1.2 Erklärungen für homosexuellenfeindliche Einstellungen
1.3 Verbreitung homosexuellenfeindlicher Vorurteile und Einstellungen
1.4 Hass- und vorurteilsbasierte Gewalt
1.5 Motive und Ursachen für homosexuellenfeindliche Gewalt
2 Inzidenz homosexuellenfeindlicher Gewalt
3 Prävention homosexuellenfeindlicher Gewalt
4 Untersuchung der Gewalt gegen homosexuelle Männer: Ansatz und Vorgehen
4.1 Konzeptualisierung
4.2 Datenbasis der Untersuchung
5 Untersuchung der Gewalt gegen homosexuelle Männer: Darstellung der Ergebnisse
5.1 Unterschiede im institutionellen Verständnis von homosexuellenfeindlicher Gewalt
5.2 Homosexuellenfeindliche Straftaten in Berlin: quantitative Annäherungen
5.3 Expertenschätzungen zum Stellenwert homosexuellenfeindlicher Gewalt in Berlin
5.4 Homosexuellenfeindliche Straftaten in Berlin: qualitative Annäherungen
6 Untersuchung der Gewalt gegen homosexuelle Männer: feindselige Einstellungen und Stereotype im Kontext unterschiedlicher Tatsituationen
7 Untersuchung der Gewalt gegen homosexuelle Männer: Ertrag für die Präventionsarbeit
8 Quellen
Mark Zöller
Der Einsatz von Bodycams zur polizeilichen Gefahrenabwehr rechtliche Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel des rheinland-pfälzischen Pilotprojekts
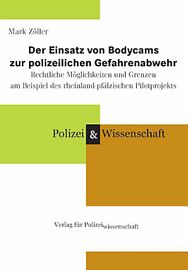
Inhalt
Inhalt
VORWORT
ABKüRZUNGSVERZEICHNIS
A. DAS RHEINLAND-PFäLZISCHE PILOTPROJEKT
B. KURZBESCHREIBUNG DER UNTERSUCHUNG
C. RECHTSGUTACHTEN
I. VORBEMERKUNGEN
II. VERFASSUNGSRECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
1. Allgemeines
2. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht
a) Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
aa) Schutzbereich
bb) Eingriff
cc) Rechtfertigung
b) Das Recht am eigenen Bild und das Recht am gesprochenen Wort
3. Zwischenergebnis
III. BODYCAM-EINSATZ AUF DER GRUNDLAGE DES GELTENDEN POG RP
1. Regelungsgehalt des § 27 POG RP
a) § 27 Abs. 1 POG RP
b) § 27 Abs. 2 POG RP
c) § 27 Abs. 3 POG RP
d) § 27 Abs. 4 POG RP
e) Weitere Regelungen
2. Zwischenergebnis
IV. VERFASSUNGSRECHTLICHE RECHTFERTIGUNG
1. Gesetzgebungskompetenz
2. Bestimmtheitsgebot
3. Verhältnismäßigkeit
a) Legitimer Zweck
b) Geeignetheit
c) Erforderlichkeit
d) Angemessenheit
aa) Allgemeines
bb) Anlassbezogene überwachung
cc) Offenheit
dd) Löschungspflichten
ee) Einrichtung einer unabhängigen Treuhandstelle
4. Zwischenergebnis
V. ZULäSSIGKEIT DER PRERECORDING-FUNKTION
VI. BESONDERHEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERSAMMLUNGEN
VII. EINSATZMöGLICHKEITEN IN WOHNUNGEN
1. Schutzbereich des Art. 13 Abs. 1 GG und Eingriff
2. Rechtfertigungsmöglichkeiten
a) Vorgaben des Art. 13 Abs. 4 GG
b) Vorgaben des Art. 13 Abs. 5 GG
3. Der nordrhein-westfälische Sonderweg
a) Eingriffsqualität
b) Rückgriff auf den Eingriffsvorbehalt des Art. 13 Abs. 7 GG?
4. Zwischenergebnis
D. ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNGEN
LITERATURVERZEICHNIS
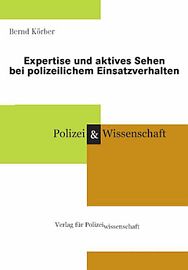
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
1. THEORETISCHER TEIL
1.1. GEGENSTAND UND ZIELE DER VORLIEGENDEN SCHRIFT
1.2. PSYCHOLOGISCHE FORSCHUNG MIT DER UND üBER DIE POLIZEI
1.3. BLICKPFADE ALS GEGENSTAND PSYCHOLOGISCHER FORSCHUNG
1.4. VISUELLE EXPERTISE
1.5. TRAINING ALS MAßNAHME ZUM ERWERB VON EXPERTISE: SELEKTION, KOGNITIVE VERARBEITUNG, AUFMERKSAMKEIT UND BLICKVERHALTEN
1.6. PRIMING ALS EXPERIMENTELLE MANIPULATION
1.7. AUFBAU DES EXPERIMENTELLEN TEILS
2. ZEITLICHE ANALYSE VISUELLER INFORMATIONSVERARBEITUNG BEI BERUFSBEZOGENER VISUELLER SUCHE
2.1. EXPERIMENT 1: ENTWICKLUNG DES PARADIGMAS
2.2. EXPERIMENT 2: EINSATZRELEVANTE KATEGORIEN
2.3. EXPERIMENT 3: MONITORüBERWACHUNG (VISUELLES SITUATIONSPRIMING)
3. EINFLüSSE EINER HANDLUNGSVERANLASSUNG AUF DIE SUKZESSIVE ZEITLICHE ABFOLGE VISUELLER INFORMATIONSVER-ARBEITUNG BEI VISUELLER SUCHE
3.1. EXPERIMENT 4: HANDLUNGSNOTWENDIGKEIT BEI VISUELLER SUCHE IN EINSATZRELEVANTEN SZENARIEN
3.2. EXPERIMENT 5: HANDLUNGSNOTWENDIGKEIT BEI DER MONITORüBERWACHUNG
4. FöRDERUNG BERUFSBEZOGENER VISUELLER SUCHE DURCH UNMITTELBARE INDUZIERUNG BILDHAFTEN, AUFGABENSPEZIFISCHEN WISSENS
4.1. EXPERIMENT 6: PIKTORIALES OBJEKTPRIMING ZUR FöRDERUNG POLIZEILICHEN EINSATZVERHALTENS BEI EINSATZRELEVANTEN KATEGORIEN
4.2. EXPERIMENT 7: PIKTORIALES SITUATIONSPRIMING ZUR FöRDERUNG POLIZEILICHEN EINSATZVERHALTENS BEI DER MONITORüBERWACHUNG
5. RäUMLICHE ANALYSE BERUFSBEZOGENER, BILDHAFTER SZENARIEN BEI VISUELLER SUCHE
5.1. EXPERIMENT 8: RäUMLICHE EFFIZIENZ VON SUCHVERHALTEN BEI POLIZEIRELEVANTEN EINSATZKATEGORIEN
5.2. EXPERIMENT 9: EFFIZIENZ RäUMLICHER DURCHMUSTERUNGEN BEI POLIZEILICHER MONITORüBERWACHUNG
5.3. REANALYSE DER EXPERIMENTE MIT POLIZEILICHEN EXPERTEN ALS UNTERSUCHUNGSGRUPPEN
6. EINFLüSSE POLIZEILICHER EXPERTISE AUF BERUFSBEZOGENE VISUELLE AUFMERKSAMKEITSLEISTUNGEN UND BLICKSTRATEGISCHES VERHALTEN üBER DIE ZEIT
6.1. EXPERIMENT 10: BILDGESTEUERTE AUFMERKSAMKEITSBINDUNG IN REAL-WORLD-SZENARIEN
6.2. EXPERIMENT 11: EINFLUSS POLIZEILICHER VISUELLER EXPERTISE BEI OBSERVATIONSAUFGABEN
7. ABSCHLUSSDISKUSSION
7.1. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
7.2. EIN ARBEITSMODELL FüR UNTERSUCHUNGEN ZUR VISUELLEN EXPERTISE
7.3. VISUELLE EXPERTISE BEI OPERATIVER POLIZEILICHER TäTIGKEIT – ERKENNTNISGEWINN UND SICHERHEIT AUF DEM WEG ZU ANGEWANDTER WISSENSCHAFT
7.4. IMPLEMENTIERUNG NEUROPSYCHOLOGISCHER ERKENNTNISGEWINNUNG IN DIE ORGANISATION POLIZEI – EIN AUSBLICK
8. LITERATUR
Ina Teschlade
'Ware Frau’ – Auswirkungen der Legalisierung von Prostitution Dokumentenanalyse zur Reform des Prostitutionsgesetzes zur Unterbindung von Zwangsprostitution
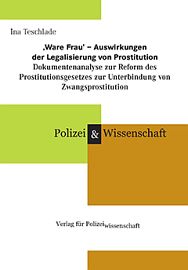
In diesem Buch werden Dokumente wie Drucksachen des Deutschen Bundestages und Bundesrates sowie die Positionspapiere von ausgewählten Nichtregierungsorganisationen dahingehend analysiert, welche Vorschläge zur Reform des Prostitutionsgesetzes gemacht werden, um Zwangsprostitution als Form des Frauenhandels zu unterbinden. Die Drucksachen und die Positionspapiere „Appell für Prostitution“ sowie der „Appell gegen Prostitution“ werden ausgewertet und in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden gegenübergestellt.
Inhalt
Inhaltsverzeichnis:
I. Einleitung
II. Theorieteil: überblick zu Prostitution und dem Prostitutionsgesetz
1. Kriminologisch-soziologische Begriffsgeschichte und unterschiedliche Erscheinungsformen der Prostitution
1.1 Prostitution
1.1.1 Prostitution als sexuelle Dienstleistung – ein historischer überblick
1.1.2 Prostitution in der Frauen- und Geschlechterforschung
1.1.3 Prostitution aus kriminologischer Perspektive
1.1.4 Erscheinungsformen der Prostitution
1.2 Zwangsprostitution und Frauenhandel
1.2.1 Begriffliche Differenzierung: Prostitution und Zwangsprostitution
1.2.2 Juristische Begriffsbestimmung: Zwangsprostitution und Frauenhandel
1.2.3 Erscheinungsformen der Zwangsprostitution
2. Das Prostitutionsgesetz vom 01.01.2002: Rechtliche Veränderungen und Auswirkungen in der Praxis
2.1 Das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (ProstG)
2.1.1 Die Vorgeschichte des Prostitutionsgesetzes
2.1.2 Der Gesetzestext des Prostitutionsgesetzes und sein Regelungsgehalt
2.1.3 Der Normzweck und eine kritische Betrachtung des Prostitutionsgesetzes
2.2 Die änderungen strafrechtlicher Vorschriften im Zuge des Prostitutionsgesetzes
2.2.1 Die strafrechtliche änderung des § 180a Abs.1 StGB: Ausbeutung von Prostituierten
2.2.2 Die strafrechtliche änderung des § 181a Abs.2 StGB: Gewerbsmäßig fördernde Zuhälterei
2.3 Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes in der Praxis
2.3.1 Auswirkungen auf die Strafverfolgung
2.3.2 Auswirkungen auf die Beratungsstellen
2.4 Reformvorschläge zum Prostitutionsgesetz
2.4.1 Aufhebung des „Vermieterprivilegs“ (§ 180a Abs.2 Nr.2)
2.4.2 Bestrafung der Freier
2.4.3 Aufenthaltsstatus
2.4.4 Kontrolle der Prostitution
2.5 Zwischenfazit
III. Empirische Untersuchung zur Reform des Prostitutionsgesetzes
3. Statistischer überblick: Zwangsprostitution vor und nach der Einführung des Prostitutionsgesetzes
4. Qualitative Inhaltsanalyse: Reformvorschläge zum Prostitutionsgesetz
4.1 Die qualitative Inhaltsanalyse als mehrstufiges Auswertungsverfahren
4.1.1 Zusammenfassende Darstellung
4.1.2 Vorstellung des entwickelten Kategoriensystems zur Analyse des Materials
4.2 Auswertung und Analyse der Drucksachen
4.3 Auswertung der Positionspapiere („Appell für Prostitution“)
4.3.1 Auswertung der Positionspapiere / Stellungnahmen „Doña Carmen e.V.“
4.3.2 Auswertung der Positionspapiere / Stellungnahmen „Hydra e.V.“
4.4 Auswertung der Positionspapiere („Appell gegen Prostitution“)
4.4.1 Auswertung der Positionspapiere / Stellungnahmen „Terre des Femme e.V.“
4.4.2 Auswertung der Positionspapiere / Stellungnahmen „Solwodi Deutschland e.V.“
5. Fazit
IV. Resümee
Sandra Hahn & Lisa Maldener
Neonatizid eine Einzelfallrekonstruktion zum Phänomen der Neugeborenentötung
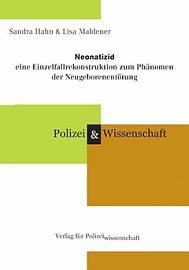
Um diese Frage zu beantworten wurde von den Autorinnen innerhalb einer qualitativen Arbeit ein Einzelfall rekonstruiert. Die Kindsmutter hat ihr Neugeborenes unmittelbar nach der Geburt im Schnee ausgesetzt, was den Tod des unbekleideten Säuglings zur Folge hatte. Anschließende Gutachten und Vernehmungen, wie z.B. die der Eltern der Kindsmutter sowie ihres Freundes, welche die Schwangerschaft nicht bemerkt haben wollen, wurden hierfür analysiert.
Daraus resultierende Ergebnisse können sowohl im Kontext (kriminal)polizeilicher Ermittlungsarbeit herangezogen werden als auch zur Erkenntnisgewinnung in Bezug auf Fragen von sozialwissenschaftlicher Relevanz beitragen. Mittels der Analyse unterschiedlicher Vernehmungen und Gutachten kann das Tathandeln in Bezug auf die Abgrenzung einer negierten oder nicht bemerkten Schwangerschaft herausgestellt werden, was nicht nur für die polizeilichen Ermittlungen von Interesse ist. Auch können diese Aspekte im Vorhinein einer derartigen Tat von Nutzen sein, wenn die negierte Schwangerschaft als Risikofaktor in der Gesellschaft bekannt und wahrgenommen wird.
Inhalt
Inhalt
VORWORT
EINFüHRUNG – ZUM ANLIEGEN DER STUDIE
1. PHäNOMENOLOGIE
1.1 Eine Begriffsdiskussion
1.2 Erscheinungsformen des Neonatizids
1.2.1 Zur aktiven Form der Tatbegehung
1.2.2 Zur passiven Form der Tatbegehung
1.2.3 Die Abgrenzung zur Aussetzung eines Säuglings
1.2.4 Die Angaben der Kindsmutter und die objektiven Daten der rechtsmedizinischen Gutachten – ein Vergleich
1.2.5 Zur Auffindesituation der Neugeborenen
2. ZUR MOTIV- UND URSACHENFORSCHUNG: NEGIERTE SCHWANGERSCHAFT
2.1 Entstehung und Verlauf einer negierten Schwangerschaft
2.2 Zur Differenzierung zwischen Verdrängung und Verheimlichung
3. DIE GELTENDE RECHTSLAGE IN DEUTSCHLAND
3.1 Zum strafrechtlichen Beginn des ›Menschseins‹ – eine Abgrenzung zu den Vorschriften des Schwangerschaftsabbruchs gemäß §§ 218 ff. StGB
3.2 Zur Abschaffung des Sondertatbestands der Kindstötung gem. § 217 StGB
3.3 Gegenwärtige Rechtslage und Strafmaß
3.4 Rechtsmedizinische Erkenntnisse und Vorgehen bei Verdacht auf Neonatizid
3.4.1 Feststellung des Neugeborenseins
3.4.2 Feststellung der Reife und der Lebensfähigkeit des Säuglings
3.4.3 Feststellung des Gelebthabens des Neugeborenen
3.4.4 Feststellung der Todesursache des Kindes
4. HANDLUNGSALTERNATIVEN – EINE WIRKSAME OPTION ODER DIE ERöFFNUNG EINER GESETZESWIDRIGEN HANDLUNG?
4.1 Die anonyme Geburt
4.2 Die vertrauliche Geburt
4.3 Babyklappen
4.3 Rechtliche Bewertung der Handlungsalternativen Babyklappen und anonymen Geburten
4.4 Bilanzierung vorliegender Erkenntnisse im Kontext von Handlungsalternativen
5. ZUM DELIKT DES NEONATIZIDS IN DER PRAXIS – EINE EINZELFALLSTUDIE
6. DATENSCHUTZ
7. FORSCHUNGSDESIGN – ZUR LOGIK DER METHODISCHEN VORGEHENSWEISE
8. ANALYSE DES AUSDRUCKSMATERIALS
8.1 Ereignisschilderung
8.2 Analyse der objektiven Daten
8.3 Analyse des transkribierten Notrufs
8.4 Analyse der Vernehmung des Kindsvaters sowie Freund der Kindsmutter
8.5 Analyse der Vernehmung des Vaters der Kindsmutter
8.6 Analyse der Vernehmung der Mutter der Kindsmutter
8.7 Analyse des Gutachtens der Kindsmutter
8.8 Informationen zum Obduktionsbericht des toten Säuglings
9. REKONSTRUKTIONSLOGISCHE GESAMTINTERPRETATION – ZUSAMMENFASSUNG DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE
10. FAZIT
QUELLENVERZEICHNIS
Oliver Jacob
Täter-Opfer-Ausgleich und Polizei Grenzen und Perspektiven einer Zusammenarbeit im Ermittlungsverfahren
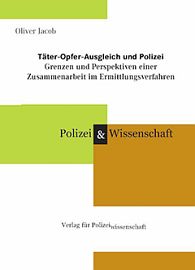
Bisher nahezu nicht beforscht ist die Haltung von Polizisten zum Thema Täter-Opfer-Ausgleich. Der erste empirische Teil der Arbeit zeigt kollektive Orientierungen und Handlungsmuster auf, quasi das polizeiliche Bauchgefühl, wenn es um das Thema Täter-Opfer-Ausgleich geht, wie auch der Wunsch nach effektiven und wirksamen Interventionsformen. Im zweiten empirischen Teil werden TOA-Vermittler aus mehreren Bundesländern zu ihren Erfahrungen, konzeptionellen überlegungen und Wünschen im Hinblick auf eine Zusammenarbeit mit der Polizei befragt – die nach wie vor stark ausbaufähig ist.
Die Forschungsteile werden eingeleitet und gerahmt durch viel Wissenswertes zum Thema Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafverfahren. Die vorliegende Arbeit ist ein Buch aus der Praxis, für die Praxis. Der Autor arbeitet seit fast zwei Jahrzehnten als Vermittler im Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafverfahren, gibt Informationsveranstaltungen und hält Vorträge zum Thema und ist dabei ein beständiger Ansprechpartner für die Polizei des Landes Berlin. Das Buch wendet sich an Jugendsachbearbeiter und Jugendsachbearbeiterinnen der Polizei, Präventionsbeauftragte, Opferschutzbeauftragte, Stabsmitarbeiter, Polizeischüler und Polizeischülerinnen, Polizeiforscher und Polizeiforscherinnen, Kriminologen und Kriminologinnen sowie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den TOA-Fachstellen.
Inhalt
Inhalt
I. Ein Wort vorweg
II. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
1 Der Täter-Opfer-Ausgleich im (Jugend)Strafverfahren
1.1 Anliegen und Ziele eines Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA)
1.2 Der Täter-Opfer-Ausgleich in Deutschland
1.3 Wegmarken in der Entwicklung des Täter-Opfer-Ausgleichs
1.4 Die Effizienz des Täter-Opfer-Ausgleichs
2 Der Täter-Opfer-Ausgleich in Theorie und Praxis
2.1 Methodenvielfalt im Täter-Opfer-Ausgleich: Konstrukt eines Handlungsmodells
2.2 Ansätze und Haltungen in der Vermittlertätigkeit
2.3 Hürden und Etappen der Konfliktschlichtung
2.4 Rolle und Aufgaben der Vermittler
2.5 Täter-Opfer-Ausgleich: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Versuch einer Standortbestimmung
2.6 Anwendungsbereiche und (neues) Fallpotenzial für den TOA
3 Polizei und Täter-Opfer-Ausgleich
3.1 Die Polizei in Deutschland
3.2 Polizei und Kriminalprävention
3.3 Die Rolle der Polizei im Jugendstrafverfahren
3.4 Polizeiliche Jugendarbeit
3.5 Die Beteiligung der Polizei am Prozess eines Täter-Opfer-Ausgleichs
3.6 Die Möglichkeiten der Polizei, einen Täter-Opfer-Ausgleich „anzuregen“
3.7 Polizei im Focus der Wissenschaften: Annäherung an ein Forschungsfeld
4 Empirische Analyse Teil I: Rekonstruktion kollektiver Orientierungen und Handlungspraktiken von Polizeibeamten
4.1 Forschungsinteresse, Fragestellung und Ziel der Untersuchung
4.2 Planung und Durchführung der Gruppendiskussionen
4.3 Transkription, Interpretation und Typenbildung
4.4 Rekonstruktion von konjunktiv geteilten Orientierungen und Handlungspraktiken in Bezug auf den Täter-Opfer-Ausgleich in der polizeilichen Fallpraxis
5 Empirische Analyse Teil II: Rekonstruktion von Handlungpraktiken von Täter-Opfer-Ausgleichs Vermittlern
5.1 Forschungsinteresse, Fragestellung und Ziel der Untersuchung
5.2 Vorüberlegungen und Stand der Erkenntnis
5.3 Das Experteninterview als geeignete Methode der Rekonstruktion von Handlungsorientierungen
5.4 Erfahrungen und Handlungsorientierungen von TOA-Vermittlern in der Zusammenarbeit mit der Polizei
6 Täter-Opfer-Ausgleich und Polizei: Ergebnisse und Ausblick
6.1 Warum die Zusammenarbeit mit der Polizei wichtig für die Weiterentwicklung des TOA in Deutschland ist
6.2 Welche Rolle der Täter-Opfer-Ausgleich für die Arbeit der Polizei spielen kann
6.3 Faktoren für eine funktionierende Kooperation, Hürden und Grundlagen
6.4 Anreize für einen kriminalpolitischen Diskurs
Anhang

Dieser Band versteht sich als eine Bestandsaufnahme des aktuellen polizeilichen Wissens. In ihm wird dargelegt, welche Wissensformen sich bei der Polizei beobachten lassen, wie Wissen zwischen Polizei und nicht-polizeilichen Akteuren ausgetauscht wird und wie Führung und Wissen bei der Polizei zusammenfinden. Dabei sind die hier vertretenen Autorinnen und Autoren weniger am Soll-Zustand interessiert, der z.B. in Organigrammen vorgezeichnet wird als am Ist-Zustand der unmittelbaren Polizeiarbeit. Die Texte sind deswegen ethnographischer Natur, basieren auf Interviews oder übertragen Erfahrungen aus der Gewalt- und Wissenssoziologie auf polizeiliche Wissensbildungsprozesse.
Die meisten Autorinnen und Autoren sind bereits mit eigenständigen Forschungen über die Polizei in Erscheinung getreten. Einige von ihnen unterrichten an Polizeihochschulen, andere forschen zur Polizei oder zur Wissenssoziologie. In diesem Band folgen sie dem Ratschlag des US-amerikanischen Philosophen John Dewey, der Staat müsse immer wieder neu entdeckt werden, weil sich die Bedingungen des Wissens fortlaufend änderten. Was das für die Polizei bedeuten kann, findet sich in diesem Sammelband beschrieben.
Inhalt
Inhalt:
Einleitung zum Sammelband: Polizeiliches Wissen
(Jonas Grutzpalk)
Die Erforschung des Wissensmanagements in Sicherheitsbehörden mit Hilfe der Akteurs-Netzwerk-Theorie
(Jonas Grutzpalk)
Raumwissen: Die Produktion von Raum bei der Polizei
(Daniela Hunold)
Im Bild(e) sein - Polizeiliche Arbeit im Sozialraum
(Christiane Howe)
über Datenbanken und Datenanalysetools: Die polizeiliche Konstruktion von Wissen und Verdacht in soziotechnischen Netzwerken
(Niklas Creemers)
Eins Zwei Polizei, Drei Vier Offizier. Was wissen Polizei und Bundeswehr voneinander?
(Lena Lehmann)
Autorität. Das implizite Wissen von Vorgesetzten und Nachgeordneten um den Führungserfolg
(Christian Barthel und Dirk Heidemann)
Situationen, Erfahrungen und Gewalt. Gewalt- und emotionssoziologische Forschungsperspektiven
(Rainer Schützeichel)
Autorinnen und Autoren