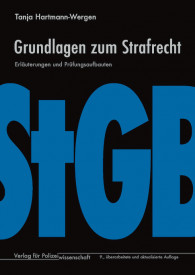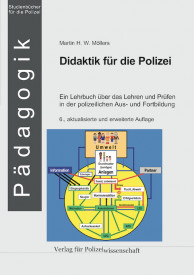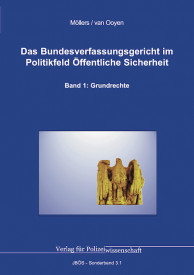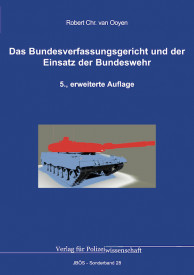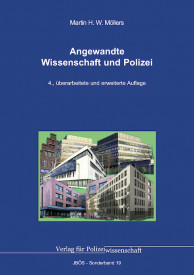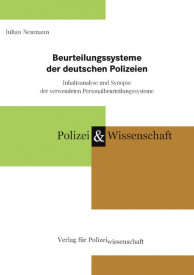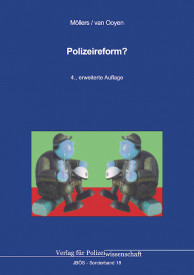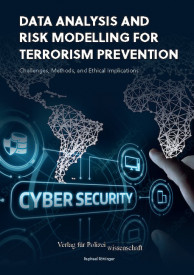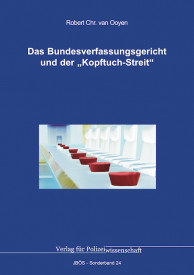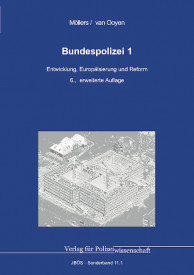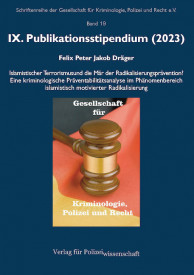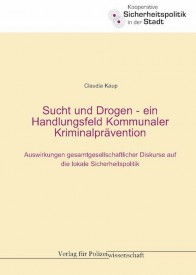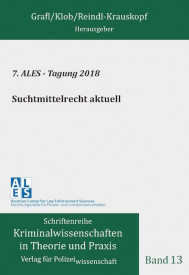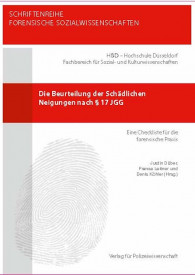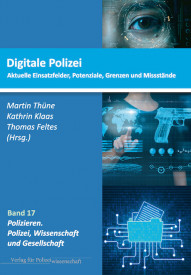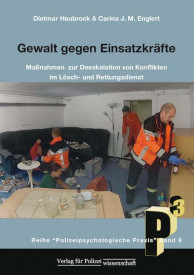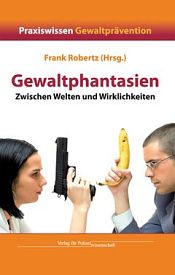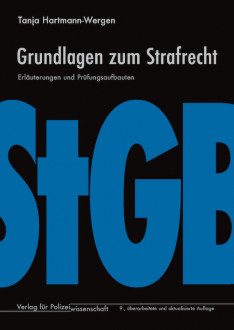
Lehrbücher
Tanja Hartmann-Wergen
Grundlagen zum Strafrecht Erläuterungen und Prüfungsaufbauten 9., überarbeitete und aktualisierte Auflage
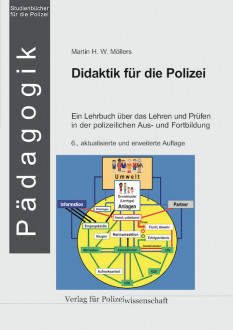
Schriftenreihen
Martin H. W. Möllers
Polizei und Didaktik Ein Lehrbuch über das Lehren und Prüfen in der polizeilichen Aus- und Fortbildung 6., aktualisierte und erweiterte Auflage

Schriftenreihen
Martin H. W. Möllers
Empirische Methoden in Studien der Polizei Experteninterview und Fragebogen 3., aktualisierte und erweiterte Auflage
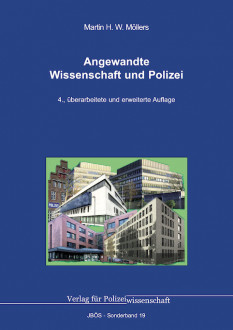
Schriftenreihen
Martin H. W. Möllers
Angewandte Wissenschaft und Polizei 4., überarbeitete und erweiterte Auflage Jahrbuch Öffentliche Sicherheit – Sonderband 19
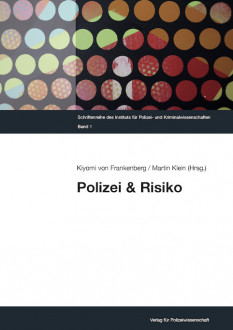
Schriftenreihen
Kiyomi von Frankenberg / Martin Klein (Hrsg.)
Polizei & Risiko
Tanja Hartmann-Wergen
Grundlagen zum Strafrecht Erläuterungen und Prüfungsaufbauten 9., überarbeitete und aktualisierte Auflage
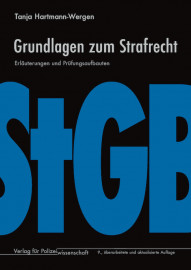 ISBN 978-3-86676-942-7
ISBN 978-3-86676-942-7
Aber auch dem in der Praxis befindlichen Polizeibeamten wird das Buch eine Hilfe sein, wenn er schnell und wirksam die einzelnen Voraussetzungen eines Straftatbestandes rekapitulieren möchte.
Inhalt
Inhalt:
Kapitel I - Grundlagen zum Strafrecht
1. Gesetzliche Grundlagen
2. Die Systematik des Strafgesetzbuches
3. Strafrechtliche Grundbegriffe
4. Die Methode der Fallbearbeitung im Überblick
5. Unterscheidung Urteilsstil – Gutachtenstil
6. Der prüfungstechnische Aufbau von Grundtatbestand und Qualifikation
Kapitel II - Allgemeingültige Prüfungsaufbauten zum Strafrecht
1. Vollendetes vorsätzliches Begehungsdelikt
2. Versuchtes vorsätzliches Begehungsdelikt mit Erläuterungen zum Rücktritt gemäß § 24 StGB
3. Fahrlässigkeitsdelikt
4. Erfolgsqualifiziertes Delikt
5. Vorsätzliches unechtes Unterlassungsdelikt
6. Fahrlässiges unechtes Unterlassungsdelikt
7. Mittelbare Täterschaft – § 25 Abs. 1, 2. Alt. StGB
8. Mittäterschaft, getrennter Aufbau – § 25 Abs. 2 StGB
9. Mittäterschaft, gemeinsamer Aufbau – § 25 Abs. 2 StGB
10. Anstiftung – § 26 StGB
11. Beihilfe – § 27 StGB
12. Versuchte Anstiftung zum Verbrechen – § 30 Abs. 1 StGB
13. Strafbare Vorstufen der Verbrechensbeteiligung – § 30 Abs. 2 StGB
14. Notwehr – § 32 StGB
15. Notwehrexzess – § 33 StGB
16. Rechtfertigender Notstand – § 34 StGB
17. Entschuldigender Notstand – § 35 StGB
18. Übergesetzlich entschuldigender Notstand
19. Einwilligung
20. Defensivnotstand – § 228 BGB
21. Aggressivnotstand – § 904 StGB
Kapitel III - Deliktsspezifische Prüfungsaufbauten zum Strafrecht
1. Widerstand gegen die Staatsgewalt (§§ 110 – 121 StGB)
2. Straftaten gegen die öffentliche Ordnung (§§ 123 – 145 d StGB)
3. Geld- und Wertzeichenfälschung (§§ 146 – 152 b StGB)
4. Falsche uneidliche Aussage und Meineid (§§ 153 – 163 StGB)
5. Falsche Verdächtigung (§§ 164 – 165 StGB)
6. Straftaten gegen den Personenstand, die Ehe und die Familie (§§ 169 – 173 StGB)
7. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 – 184 f StGB)
8. Beleidigung (§§ 185 – 200 StGB)
9. Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs (§§ 201 – 210 StGB)
10. Straftaten gegen das Leben (§§ 211 – 222 StGB)
11. Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit (§§ 223 – 231 StGB)
12. Straftaten gegen die persönliche Freiheit (§§ 232 – 241 a StGB)
13. Diebstahl und Unterschlagung (§§ 242 – 248 c StGB)
14. Raub und Erpressung (§§ 249 – 256 StGB)
15. Begünstigung und Hehlerei (§§ 257 – 262 StGB)
16. Betrug und Untreue (§§ 263 – 266 b StGB)
17. Urkundenfälschung (§§ 267 – 282 StGB)
18. Strafbarer Eigennutz (§§ 284 – 297 StGB)
19. Straftaten gegen den Wettbewerb (§§ 298 – 302 StGB)
20. Sachbeschädigung (§§ 303 – 305 a StGB)
21. Gemeingefährliche Straftaten (§§ 306 – 323 c StGB)
22. Straftaten im Amt (§§ 331 – 358 StGB)
Martin H. W. Möllers
Polizei und Didaktik Ein Lehrbuch über das Lehren und Prüfen in der polizeilichen Aus- und Fortbildung 6., aktualisierte und erweiterte Auflage
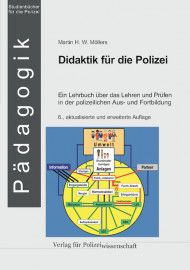 ISBN 978-3-86676-943-4
ISBN 978-3-86676-943-4
Didaktik hat bei der Polizei einen hohen Stellenwert – nicht nur, weil Aus- und Fortbildung eine bedeutende Rolle spielen. Vielmehr gibt es tagtäglich in der Praxis Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über Rechts- und Sicherheitslagen sowie neue Einsatz- und Führungsmittel auf dem Laufenden gehalten werden müssen.
Das Buch will spezielle Hilfestellung geben, Unterricht zu gestalten, Prüfungen abzunehmen und allgemein Lernerfolge in polizeilichen Lehrprozessen zu erzielen. Im Mittelpunkt der Ausführungen stehen biologische Lernvoraussetzungen sowie wissenschaftliches und didaktisches Arbeiten. Zu letzterem gehören vor allem Veranschaulichung von Lehrstoffen und optimale Unterrichtsmethoden, aber auch die Planung und Durchführung von schriftlichen und mündlichen Prüfungen sowie Lehrproben einschließlich deren Bewertungen. Es enthält Beispiele für durchgeplanten Unterricht sowie Muster- und Übungsklausuren mit Lösungsvorschlägen. Darüber hinaus sind die notwendigen Grundlagen der Forschungsmethode der Experteninterviews aufgenommen, die oft in wissenschaftlichen Abschlussarbeiten (Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten bzw. Promotionen an der DHPol in Münster) eingesetzt werden. Neue Prüfungsformate, die in den modularisierten Studiengängen an Polizeihochschulen eingeführt wurden, werden im Buch ebenfalls berücksichtigt. Dazu gehören Thesenpapier, Referat, Diplomarbeitspräsentation und Multiple-Choice-Prüfungen.
Zur Optimierung des Lernprozesses arbeitet das Buch zur Veranschaulichung für die Leserinnen und Leser mit 152 Schaubildern, die hinten im Werk zum schnellen Auffinden aufgelistet sind. Außerdem ist mit Literaturverzeichnis, Glossar der didaktischen Begriffe und einem umfänglichen Stichwortregister ein nützlicher Apparat aufgenommen, der das Arbeiten mit dem Buch erleichtern soll.
Inhalt
Inhalt:
Einführung zur Didaktik bei der Polizei
Erster Teil: L e r n e n
Zweiter Teil: L e h r e n
Dritter Teil: P r ü f e n an der (Hoch-)Schule
Vierter Teil: P r ü f e n in der Praxis
Fünfter Teil: U m s e t z u n g von Lehren und Prüfen
Sechster Teil: E r g e b n i s s i c h e r u n g
Anhang
Martin H. W. Möllers
Empirische Methoden in Studien der Polizei Experteninterview und Fragebogen 3., aktualisierte und erweiterte Auflage
 ISBN 978-3-86676-941-0
ISBN 978-3-86676-941-0
Die Polizeistudiengänge sehen wegen der ohnehin schon breiten Fülle an Lernstoff in aller Regel keine Lehrveranstaltungen zu sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden vor. Da aber in wissenschaftlichen Abschlussarbeiten, welche die Studierenden als Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit absolvieren müssen, mit zunehmenden Interesse inzwischen sehr häufig Experteninterviews und Fragebogenaktionen eingeplant werden, besteht ein Bedarf für ein Buch, in dem die Grundlagen dieser Forschungsmethoden möglichst kurz und knapp erläutert werden. Dies soll verhindern, dass der Einsatz solcher empirischer Untersuchungsmethoden laienhaft angelegt sind und dann letztlich keinen wissenschaftlichen Fortschritt erbringen. Das gilt auch für Promotionen an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster.
Mit einer komprimierten Darstellung der wichtigsten Regeln im Sinne eines Leitfadens speziell für die Polizei soll ein Mindestmaß an Wissenschaftlichkeit bei Arbeiten mit Interview und/oder Fragebogen erreicht werden.
Inhalt
Inhalt:
Die Lesekompetenz als Basis der Wissenschaftlichkeit und Grundlage der Schlüsselqualifikation für den Polizeialltag
Konkrete Überlegungen zur Wissenschaftlichkeit von Experteninterviews und Fragebogen
1. Teil: Die qualitative Forschungsmethode Experteninterview
1 Die Auswahl der geeigneten Interviewmethodik
2 Die Vorbereitung des Experteninterviews
3 Die Durchführung des Experteninterviews
4 Die Auswertung und Archivierung des Experteninterviews
2. Teil: Die quantitative Forschungsmethode Fragebogen
1 Die Suche nach geeignetem Datenmaterial
2 Die Vorbereitung des Fragebogens
3 Die Konstruktion des Fragebogens und die Durchführung der Fragebogenaktion
4 Überlegungen zu den Voraussetzungen der Repräsentativität der Daten
5 Probleme beim Rücklauf der Fragebogen
6 Die Auswertung des Fragebogens
7 Grenzen der Interpretation
Martin H. W. Möllers
Angewandte Wissenschaft und Polizei 4., überarbeitete und erweiterte Auflage Jahrbuch Öffentliche Sicherheit – Sonderband 19
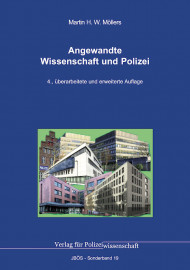 ISBN 978-3-86676-940-3
ISBN 978-3-86676-940-3
Das Buch will den Diskurs zwischen Polizeipraxis und Polizeiwissenschaft anhand einzelner Aufsätze in vier Kapiteln und einer Dokumentation aufzeigen. Den Anfang markiert die Einführung in die historische Entwicklung der Polizeiwissenschaften in Deutschland. Ihr folgt die ständig wiederkehrende Debatte um Praxis (angewandte Polizei-„Wissenschaft“) und Theorie (Polizeihochschule) mit der wissenschaftlichen Analyse, ob ein Polizeipraktiker überhaupt Wissenschaft braucht. Dabei geht es um Schlüsselqualifikationen für den Polizeiberuf sowie um die biologischen und pädagogischen Voraussetzungen bei der didaktischen Umsetzung der polizeiwissenschaftlichen Themen in Praxis und Theorie. Dazu gehören auch Modelle der Interaktion zwischen Mensch und Computer und ihre Umsetzung in den Polizeialltag. Die Resolution des Arbeitskreises Empirische Polizeiforschung, die Polizei und Forschung einfordert, wird abschließend dokumentiert.
Inhalt
Inhalt:
Einführung
Einführung zur Polizeiwissenschaft als angewandte Wissenschaft
Angewandte Polizeiwissenschaft und Polizeihochschule
Die Studienziele der Polizeiausbildung für Führungskräfte in Bund und den Ländern
Von der Notwendigkeit einer Bachelor- oder Diplomarbeit für die polizeiliche Praxis
Das Verhältnis von Theorie und Praxis: Gebührt der Praxis beim Studium an der Polizeihochschule der Vorrang?
Anwendung von Theorien in der Praxis
Polizeiwissenschaft und Didaktik
PISA und Polizei – Zur Lesekompetenz im Hochschulstudium als Schlüsselqualifikation für den Polizeiberuf
Lehr- und Lernprozesse bei den Polizeien im Bund und den Ländern – Zur Verortung der Begriffe ,Didaktik‘ und ,Methodik‘
Biologische Zusammenhänge und Voraussetzungen für das Lernen in der Polizeipraxis und in der Theorie
Digitale Wissenschaft‘ bei der Polizei
Die Interaktion zwischen Mensch und Computer
Moderne Unterrichtsmodelle für das Polizeistudium
Dokumentation
Resolution des Arbeitskreises Empirische
Quellen- und Literaturliste
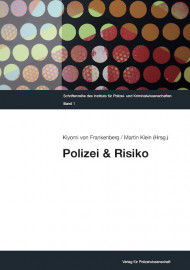 ISBN 978-3-86676-890-1
ISBN 978-3-86676-890-1
Der vorliegende Sammelband zum Thema „Polizei und Risiko“ umfasst unterschiedliche Perspektiven, die sich mit dem Spannungsfeld zwischen Sicherheit als klassischer Polizeiaufgabe und Risiko als neuartiger Entwicklung in einer sich stetig wandelnden gesellschaftlichen Realität befassen.
Dabei ist er interdisziplinär angelegt und betrachtet rechtswissenschaftliche, soziologische, kriminologische aber auch polizeipraktische Fragen auf aktuelle Herausforderungen und Fragestellungen aus dem System der Polizei und aus der Perspektive der Wissenschaft über den Umgang von Polizei mit Risiken. Einen Schwerpunkt bilden hierbei die Voraussetzungen für die richtige Einschätzung von Risiken. Dies betrifft zum einen die Grenzen rechtsstaatlich zulässiger Präventionsmaßnahmen. Zum anderen geht es um die Frage, wie die Polizei (neue) technische Einsatzmittel nutzen kann, ohne dass es dabei zu selbstverantworteten Risiken kommt.
Damit eröffnet der Sammelband sowohl für Lehrende und Studierende als auch für Praktiker Handlungs- und Reflexionsmöglichkeiten – sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf polizeipraktischer Ebene – und entwickelt auch politische Handlungsempfehlungen.
Inhalt
Inhalt:
Der Polizeiberuf als Risiko und die polizeiliche Dienstgruppe als Versicherungsgemeinschaft gegen Rechtsfehler bei der Arbeit
Martin Weißmann
Erfolgsfaktor Polydextrie
Ronald Ivancic und Sibylle Olbert-Bock
„Das Wichtigste ist, dass wir sicher nach Hause kommen.“
Johanna Wagner und Nils Montabon
Die Anwendung des Arbeitsschutzgesetzes zur Risikoreduzierung für den Streifendienst
Tania Rusca
Risiko: Recht?
Daniel Zühlke
Die präventiv-polizeiliche Anwendung von Schusswaffen als Droh- und Zwangsmittel
Ralf Ramin und Jacek Rulinski
Die Bodycam: zwischen Peacemaker, Eskalationsfaktor und Transparenzmaschine
Tom Kattenberg
Risiken der Digitalen Forensik
Tobias Eggendorfer, Katja Andresen und Olivia Gräupner
Zum Umgang mit statistischen Informationen und deren Nutzung zur Beurteilung von Risiken in der Polizei
Christian Zimmermann
Kriminalitätsfurcht und Polizei: Wahrnehmung, Einfluss und Interventionsmöglichkeiten
Katja Jöhnke
„Vor die Lage kommen…“
Bernhard Frevel
Transformative Policing
Claudia Tutino und Julian Waleciak
Polizeiliches Handeln und psychologische Reaktanz
Stefan Hollenberg
Die Polizei im Neo-Institutionalismus
Claudia Tutino und Julian Waleciak
Einmal kriminell, immer kriminell?
Thimna Klatt
„Ich liebe die Gefahr“
Jonas Grutzpalk
Sexualdelikte als Risikosignale
Daniela Pollich
Polizeiliche Gefährdungsanalyse und Gefahrenmanagement bei (Ex-) Partnerschaftsgewalt
Vanessa Uttenweiler und Kim Marie Zibulski
Das Polizieren der Letzten Generation
Lena Harms und Jennifer Koch
Bedeutung der Gefahrenprognose im Versammlungsrecht
Stefanie Haumer