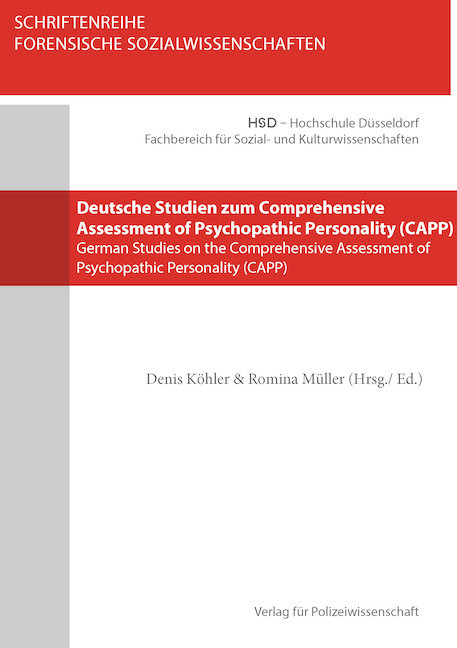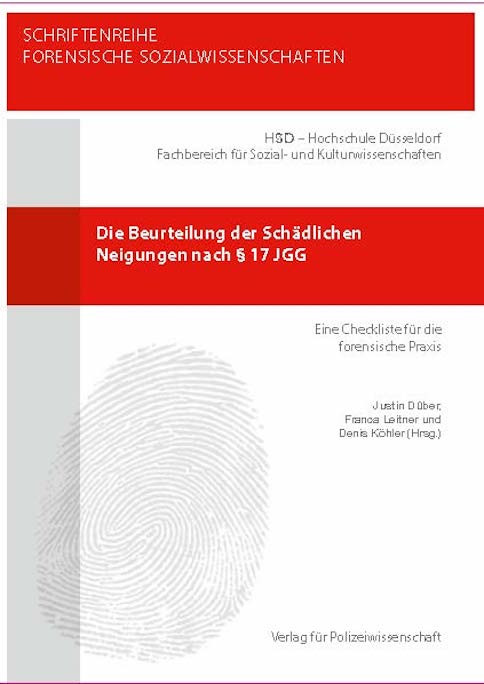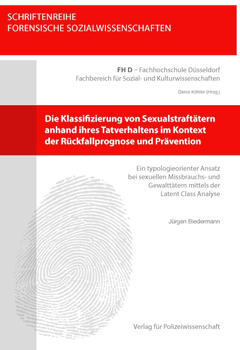Denis Köhler & Romina Müller (Hrsg./ Ed.)
Deutsche Studien zum Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) German Studies on the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP)
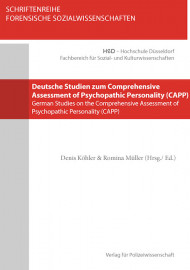
Das Konzept der Psychopathie bzw. der Psychopathy erfährt in den Medien und den Fernsehserien sowie Kinofilmen eine hohe Aufmerksamkeit. In der Wissenschaft und der rechtspsychologischen Praxis sowie der kriminologischen Praxis findet die „Psychopathische Persönlichkeit“ ebenfalls seit ca. 20 Jahren eine größere Bedeutsamkeit. Die Anzahl der Publikationen zu den verschiedenen Themenfeldern Ätiologie, Behandelbarkeit, und Gefährlichkeit ist kaum noch zu überblicken. Das „Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP)“ Projekt von David Cooke und Kolleginnen stellt einen neuen, innovativen und inspirierenden Ansatz zum Verständnis der psychopathischen Persönlichkeit dar. Im Zuge des weltweiten CAPP-Netzwerkes von internationalen Forschungsteams werden viele Projekte in Fachzeitschriften publiziert und auf Tagungen präsentiert. Das vorliegende Werk will an dieser Stelle jungen Forschern die Möglichkeit geben, ihre Arbeiten zum CAPP einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen und sichtbar zu machen. Solche wunderbaren Forschungsprojekte sollten nicht in einer dunkeln Schublade verschwinden, sondern zur wissenschaftlichen Diskussion beitragen.
Inhalt
Inhalt:
A. Vergleich des Elemental Psychopathy Assessment (EPA) mit dem Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) unter Berücksichtigung von Geschlechterdifferenzen
von Angelina Baster
B. Die faktorielle Struktur des Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) und ihre Beziehung zum Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit (FFM)
von Joscha Hausam
C. Das Konstrukt der Psychopathie. Möglichkeiten des Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality
von Benjamin Meder
D. The Mask of Sanity. Untersuchung zur Faktorenstruktur und Konstruktvalidität des Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP)
von Nasim Mehamdioua
Justin Düber, Franca Leitner und Denis Köhler (Hrsg.)
Die Beurteilung der Schädlichen Neigungen nach § 17a JGG
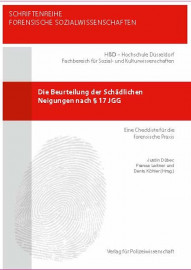
Stefanie Kemme bearbeitet das Thema unter rechtsdogmatischer Sicht und wird durch die praktischen Aspekte des Jugendrichters Edwin Pütz juristisch ergänzt. Im Weiteren stellt Matthias Bauchowitz die Qualitätsanforderungen von Stellungnahmen aus den Bereich Soziale Arbeit und Sozialpädagogik dar. Justin Düber erarbeitet den theoretischen Rahmen des §_ 17a JGG und rahmt anhand empirisch- psychologischer Befunde den Begriff der „Schädlichen Neigungen“ ein. Abschließend stellen Justin Düber, Franca Leitner und Denis Köhler die Checkliste zur forensischen Beurteilung der Schädlichen Neigungen (CFBSN) vor.
Das Buch richtet sich an Studierende und praktisch tätige Fachleute, die sich mit dem Jugendgerichtsgesetz berflich, fachlich oder wissenschaftlich beschäftigen. Insbesondere steht der interdisziplinäre Blickwinkel aus Rechtswissenschaften, Psychologie und Sozialer Arbeit / Sozialpädagogik im Vordergrund. Durch den Anwendungsbezug bietet das Werk einen direkten Nutzen für die Praxis.
Inhalt
Inhalt
Vorwort
Gedanken zum Thema schädliche Neigungen (Edwin Pütz)
1 §17 Abs. 2 JGG – Eine Hürde des Gesetzes
2 Probleme in der Praxis
3 Definition der „Schädlichen Neigungen“
4 Hervortreten in der Tat
5 Dreifacher Zeitpunkt für die Feststellung der Schädlichen Neigungen
6 Erforderlichkeit einer langfristigen Freiheitsentziehung
7 Notwendigkeit eines validen Prüfschemas
Der Begriff der „Schädlichen Neigungen“ im Geflecht von Erziehungsgedanken und Schuldprinzip (Stefanie Kemme)
1 Einleitung
2 Was sind „Schädliche Neigungen“ im Sinne des §17 II 1.Alt JGG?
3 Das Geflecht aus Schuld und Erziehung
4 Umgang der Richter mit schädlichen Neigungen
5 Folgen für die Praxis
6 Literatur
Stellungnahmen in der Jugendgerichtshilfe (JGH) (Matthias Bauchowitz und Josefin Leiste)
1 Einleitung
2 Das Doppelmandat der Jugendgerichtshilfen
3 Psychosoziale Diagnostik im forensischen Kontext
4 Qualitätsanforderungen an Stellungnahmen
5 Gedanken zur Vereinbarkeit von regelgeleiteten gutachtlichen Stellungnahmen mit ethischen Leitlinien der Sozialen Arbeit
6 Literaturangaben
Die Diagnostik Schädlicher Neigungen durch Jugendgerichtshilfen (Justin Düber)
1 Theoretischer Hintergrund
2 Ableitung der Fragestellungen
3 Methode
4 Ergebnisse
5 Diskussion
6 Literaturverzeichnis
Checkliste zur Beurteilung Schädlicher Neigungen nach §17 Abs. 2 JGG
Hinweise zur Anwendung der Checkliste
1 Allgemeine übersicht
2 Datenerhebung
3 Raten der Items
4 Fragestellungen, hypothesengeleitetes Vorgehen
5 Gesamtbeurteilung
Lebensverlauf
Aktuelle Bestandsaufnahme
Erzieherische Aspekte
Kodierungsblatt
Ableitung einer Checkliste zur Beurteilung schädlicher Neigungen (Justin Düber)
1 Ableitung einer Checkliste zur Beurteilung schädlicher Neigungen
1.1 Theorie schädlicher Neigungen
1.2 Hypothese 1 und 2: Beziehung zwischen Tat und Persönlichkeit
1.3 Diagnoseinstrumente
1.4 Ableitung konkreter psychologischer Kriterien
1.5 Diagnostischer Prozess
1.6 Fazit
1.7 Theoretischer Hintergrund der einzelnen Items
Anhang
1 Fragebogen zur Beurteilung schädlicher Neigungen
2 Q-Sort-Statements
3 Laieninstruktion: „Informationen zum Begriff schädliche Neigungen nach §17 JGG
4 Instruktionen der Q-Sort-Aufgabe
5 Faktorenmatrix der JGH-Stichprobe
6 Faktorenmatrix der Laienstichprobe
7 Grafische Darstellung der zwei Faktoren der JGH-Stichprobe
8 Grafische Darstellung der zwei Faktoren der Laienstichprobe
Autorenverzeichnis
Jürgen Biedermann
Die Klassifizierung von Sexualstraftätern anhand ihres Tatverhaltens im Kontext der Rückfallprognose und Prävention Ein typologieorienter Ansatz bei sexuellen Missbrauchs und Gewalttätern mittels der Latent Class Analyse

Mittels eines innovativen Einsatzes der Latent Class Analyse wurden acht verschiedene Täterklassen identifiziert, welche sich jeweils durch ein charakteristisches Muster der Tatbegehung auszeichneten. Eine qualitative Analyse freitextlicher Tatbeschreibungen typischer Fälle der Klassen zielte dabei in Ergänzung zu den statistischen Betrachtungen auf ein vertieftes Verständnis der Handlungslogik innerhalb der Täterklassen. Die durchgeführten Rückfälligkeitsanalysen zeigten im Weiteren auf, dass die Täterklassifikation einen wichtigen Beitrag zu einer verbesserten Risiko- und Gefährlichkeitseinschätzung von Sexualstraftätern leistet. Insbesondere konnten auch verschiedene Arten und Schweregrade von Rückfällen differenziert werden.
Aufgrund der gleichzeitigen Einnahme einer verständnisorientierten als auch empirisch-statistischen Perspektive bildet die entwickelte Täterklassifikation eine wichtige empirisch fundierte Brücke zum klinisch-ideografischen Prognoseansatz und nimmt somit Bezug auf die von unserem Rechtssystem geforderte Berücksichtigung der „durch die Tat zutage getretene(n) Gefährlichkeit“. Darüber hinaus ergeben sich durch die Klassifikation Anknüpfungspunkte für eine gezieltere Ausrichtung von Präventionsmaßnahmen auf Täter- und Opferseite
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Zur Prognose kriminellen Verhaltens
2.1.1 Die Bedeutung von Prognose und Prävention im deutschen Rechtssystem
2.1.2 Grundsätzliche (Kriminal-) Prognosestrategien
2.1.3 Die Entwicklung aktuarischer Prognoseinstrumente
2.1.4 Die Kontroverse „statistische (aktuarische) vs. klinische Prognose“
2.2 Spezifika der Sexualdelinquenz
2.2.1 Zum Entwicklungsverlauf des Sexualstrafrechts
2.2.2 Rechtliche Differenzierungen der Sexualstraftaten
2.2.3 Zur Häufigkeit, Täter- und Opfercharakteristika sowie der Strafverfolgung von Sexualdelinquenz
2.2.4 Typologien von Sexualstraftätern als Ordnungsversuch
2.2.5 ätiologische Erklärungsansätze bei Sexualdelinquenz
2.2.6 Therapeutische Ansätze bei Sexualdelinquenz
2.2.7 Rückfallraten und Rückfallprognose bei Sexualstraftätern
2.3 Das Tatbild als bislang vernachlässigter Faktor im Rahmen der Prognose von Sexualdelinquenz
2.3.1 Das Tatbild im Kontext des polizeilichen „Profilings“
2.3.2 Das Tatbild im Kontext der forensischen Prognose
3. Fragestellung
3.1 Zusammenfassung der Ausgangslage
3.2 Ziele und Hypothesen der Arbeit
3.2.1 Die Entwicklung einer Täterklassifikation von sexuellen Missbrauchs- und Gewalttätern
3.2.2 Die Bedeutung der Täterklassifikation im Kontext der Rückfallprognose
3.2.3 Weiterführende Ziele der Arbeit
3.2.4 Hintergrund und praktischer Nutzen der Arbeit
4. Methoden
4.1 Stichprobe
4.2 Erhebungsmethoden
4.2.1 Grundlegende Aspekte bei der Analyse der BZR-Auszüge
4.2.2 Basis und allgemeine Regeln bei der Kodierung der Taten
4.2.3 Die Potentiale und Einschränkungen bei der inhaltsanalytischen Erfassung der Tathergänge
4.2.4 Berücksichtigte Variablen für die Täterklassifikation mittels der LCA
4.2.5 Die Erfassung der Prognoseinstrumente
4.2.6 Kontingenz- und Prognosekriterien
4.3 Datenanalyse
4.3.1 Die Analyse von Selektionseffekten bei der Stichprobenauswahl
4.3.2 Die statistische Entwicklung der Täterklassifikation mittels der Latent Class Analyse (LCA)
4.3.3 Externe Verortung der Täterklassifikation mittels Kontingenzbetrachtungen
4.3.4 Erweiterung der LCA durch gezielte Falldarstellungen
4.3.5 Das Cox-Modell als Verfahren zur Beurteilung rückfallprognostischer Effekte
4.3.6 Die Täterklassifikation als Rückfallprädiktor (unter Einbezug des Static-99R und TBRS)
5. Ergebnisse
5.1 Stichprobenbeschreibung und Selektionseffekte
5.2 Die Entwicklung der Täterklassifikation über die LCA
5.2.1 Die Verteilung der berücksichtigten Variablen für die Täterklassifikation innerhalb der Gesamtstichprobe (Ein-Klassenlösung)
5.2.2 Die Ermittlung der optimalen Klassenanzahl zur Beschreibung der Taten
5.2.3 Statistische Beschreibung der 8-Klassenlösung
5.3 Externe Verortung der Täterklassifikation mittels Kontingenzbetrachtungen
5.3.1 Strafrechtliche Vorgeschichte
5.3.2 Soziodemografische Variablen
5.3.3 Die strafrechtliche Bewertung der Taten
5.4 Erweiterung der statistischen Betrachtungen durch gezielte Falldarstellungen typischer Vertreter der Klassen
5.4.1 Typische Einzelfalldarstellungen zu Klasse 1
5.4.2 Typische Einzelfalldarstellungen zu Klasse 2
5.4.3 Typische Einzelfalldarstellungen zu Klasse 3
5.4.4 Typische Einzelfalldarstellungen zu Klasse 4
5.4.5 Typische Einzelfalldarstellungen zu Klasse 5
5.4.6 Typische Einzelfalldarstellungen zu Klasse 6
5.4.7 Typische Einzelfalldarstellungen zu Klasse 7
5.4.8 Typische Einzelfalldarstellungen zu Klasse 8
5.4.9 Einzelfalldarstellung und Diskussion „untypischer“ Merkmalsmuster
5.5 Die Täterklassifikation als Rückfallprädiktor (unter Einbezug des Static-99R und TBRS)
5.5.1 Die Prognose des allgemeinen sexuellen Rückfalls
5.5.2 Die Prognose des schweren sexuellen Rückfalls
5.5.3 Die Prognose des sexuellen Gewaltrückfalls
5.5.4 Die Prognose des sexuellen Missbrauchsrückfalls
5.5.5 Die Prognose des (nicht-sexuellen) Gewaltrückfalls
5.5.6 Die Prognose des schweren (nicht-sexuellen) Gewaltrückfalls
5.5.7 Die Prognose des (nicht-sexuellen) sonstigen Rückfalls
6. Diskussion
6.1 Die Klassifikation von Sexualstraftätern anhand ihres Tatverhaltens
6.2 Die Klassenzugehörigkeit als singulärer Prädiktor für die Rückfallprognose
6.3 Integrative Darstellung der Täterklassen
6.3.1 Klasse 1
6.3.2 Klasse 2
6.3.3 Klasse 3
6.3.4 Klasse 4
6.3.5 Klasse 5
6.3.6 Klasse 6
6.3.7 Klasse 7
6.3.8 Klasse 8
6.4 Der Static-99R als singulärer Prädiktor für die Rückfallprognose
6.5 Der TBRS als singulärer Prädiktor für die Rückfallprognose
6.6 Die inkrementelle Validität der Täterklassifikation hinsichtlich des Static-99R und TBRS
6.6.1 Die Differenzierungen des Rückfallrisikos durch die Täterklassen unter Berücksichtigung des Static-99R und TBRS