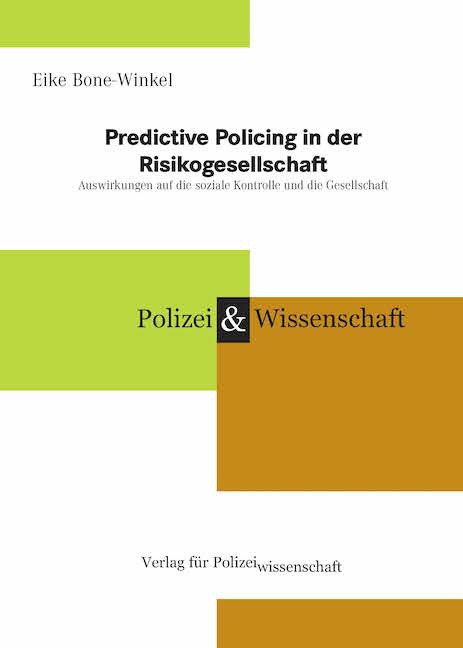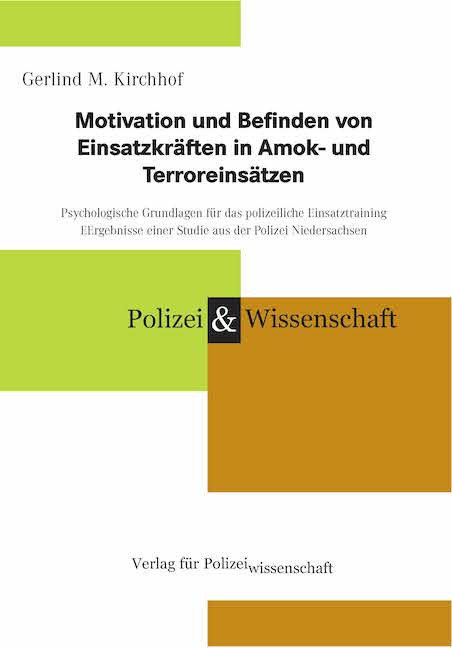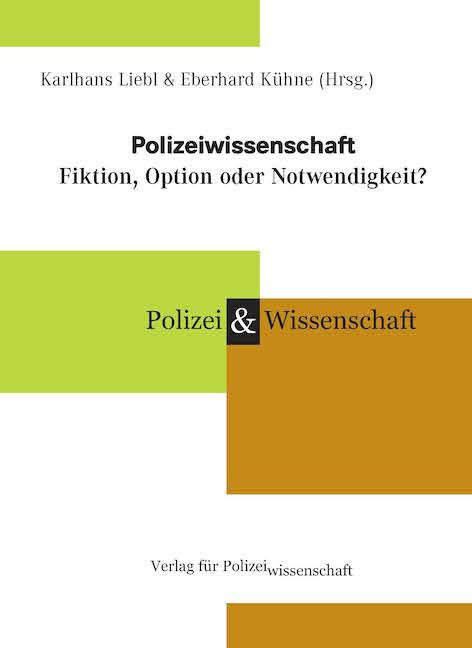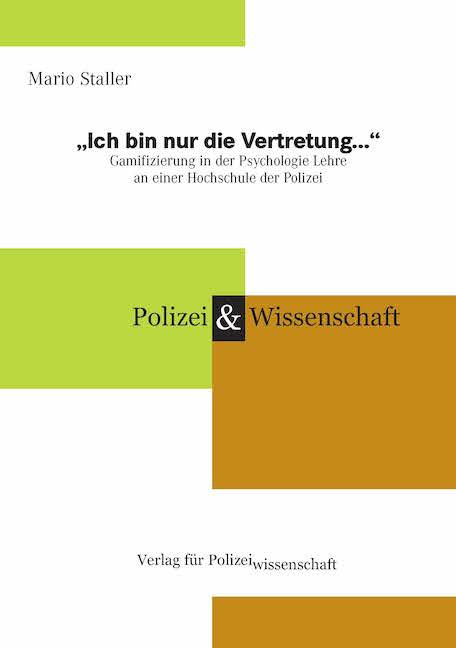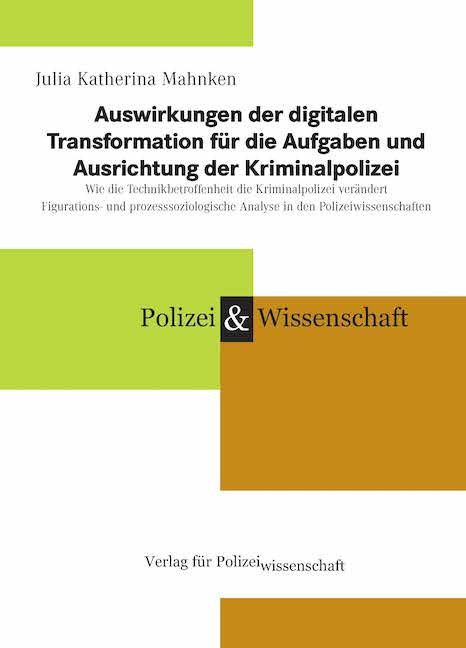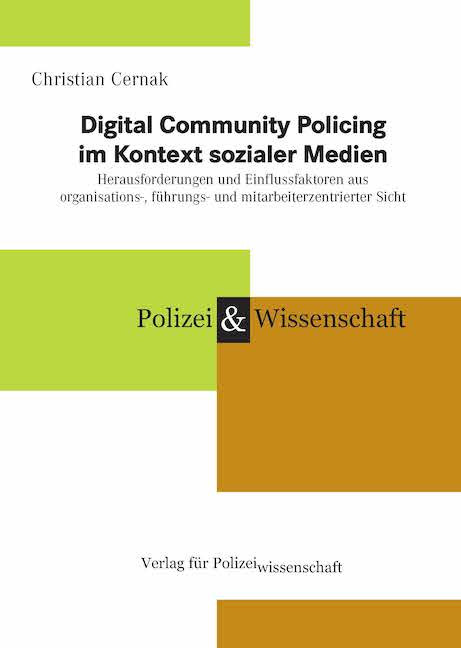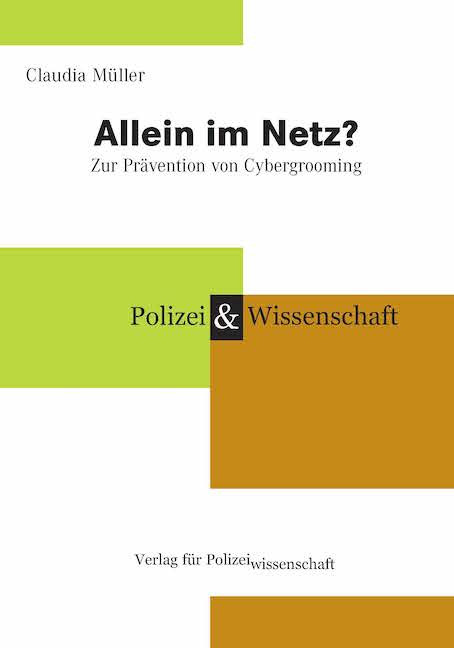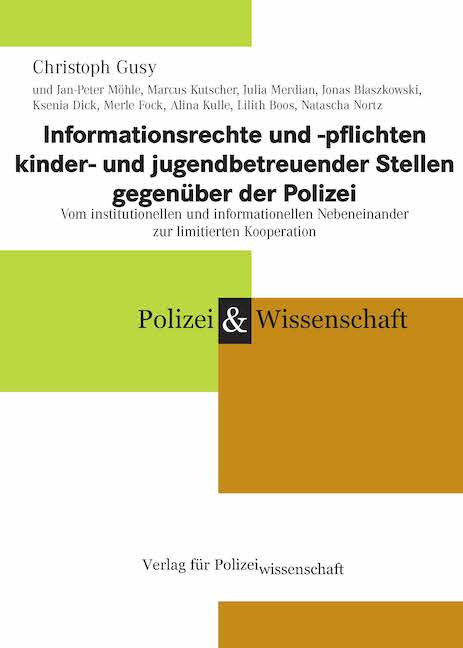Eike Bone-Winkel
Predictive Policing in der Risikogesellschaft Auswirkungen auf die soziale Kontrolle und die Gesellschaft
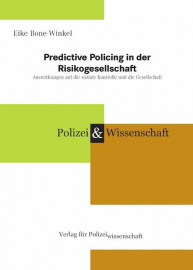
Aber können die versprochenen Effekte der Softwarelösungen überhaupt erzielt werden und wie werden sie gemessen? Welche kriminologischen Theorien sind Grundlage für die Entwicklung einzelner Softwareangebote? Was bedeutet der Einsatz für den polizeilichen Alltag? Welche Auswirkungen hat die Anwendung von Predictive-Policing-Programmen auf die Gesellschaft? Wie objektiv und frei von Diskriminierung operieren die Algorithmen, wenn sie auf einer polizeilichen Datengrundlage aus der Vergangenheit aufbauen, um daraus die Zukunft zu berechnen? Was hat gerade jetzt und in den vergangenen Jahren die Diskussion zum Einsatz von Predictive-Policing-Software beschleunigt?
Diesen und weiteren Fragen versucht dieses Buch aus dem Blickwinkel der Risikogesellschaft nachzugehen, um die bestehenden Diskussionen zum Einsatz von Predictive-Policing-Software fortzuführen und zu ergänzen.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Zielrichtung
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Die Risikogesellschaft und ihre Auswirkung auf soziale Kontrolle
2.1 Welches Risiko?
2.1.1 Soziale Kontrolle im geschichtlichen Kontext
2.1.2 Zusammenfassung der sozialen Kontrolle in der Risikogesellschaft
2.2 Die Entwicklung des Straf- und Gefahrenabwehrrechts in der Risikogesellschaft
2.2.1 Veränderungen des Gefahrenabwehrrechts
2.2.2 Veränderungen des Strafrechts
2.3 Kriminalprognostische Forderungen an die Risikogesellschaft
2.4 Der Fokus auf den Wohnungseinbruchsdiebstahl
2.4.1 Die Gefahrenlage
2.4.2 Die Zahlen
2.4.3 Der Täter
2.4.4 Die Opfer
3 Predictive Policing – Mittel und Zweck sozialer Kontrolle?
3.1 Definition von Predictive Policing im geschichtlichen Kontext
3.2 Big Data und vorausschauende Polizeiarbeit
3.3 Kriminologische Theorien mit Bezug zu Predictive Policing
3.3.1 Rational-Choice-Theorie
3.3.2 Routine-Activity-Approach
3.3.3 Kriminologie des Alltags
3.3.4 Lifestyle-Approach
3.3.5 Repeat-Victimisation
3.3.6 Near-Repeat-Victimisation
3.3.7 Boost- und Flag-Hypothese
3.4 Welche Variablen spielen in der Berechnung eine Rolle?
3.5 Theoretische Ziele bereits genutzter Softwarelösungen in Deutschland
3.5.1 SKALA – System zur Kriminalitätsauswertung und Lageantizipation .
3.5.2 PRECOBS – Pre Crime Observation System
3.5.3 PreMAP – Predictive Mobile Analytics for the Police
3.6 Auswirkungen von Predictive Policing auf die formelle soziale Kontrolle
3.7 Auswirkungen von Predictive Policing auf die Gesellschaft
4 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Gerlind M. Kirchhof
Psychologische Grundlagen für das polizeiliche Einsatztraining Motivation und Befinden von Einsatzkräften in Amok- und Terroreinsätzen Ergebnisse einer Studie aus der Polizei Niedersachsen
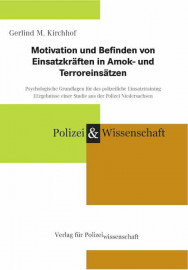
Es sind keine Spezialkräfte, sondern Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen aus dem polizeilichen Streifendienst, die heute wieder mit Maschinenpistolen trainieren, um Amok- und Terrorsituationen im ersten Angriff zu begegnen.
• Wie stehen die Einsatzkräfte selbst zu den neuen lebensbedrohlichen Einsatzsituationen?
• Was sind die zentralen Problematiken für die Einsatzkräfte im Amok- oder Terroreinsatz?
• Welche psychologischen Voraussetzungen und Trainings werden benötigt, um lebens-bedrohliche Einsatzlagen möglichst gut bewältigen zu können?
Das vorliegende Buch basiert auf einer qualitativen Interviewstudie zum Befinden und der Motivation niedersächsischer Einsatzkräfte für lebensbedrohliche Einsatz-lagen (Amok und Terror). Die befragten Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen, kommen selbst zu Wort. Sie äußern angesichts der unter Umständen sehr komplexen und gefährlichen Situationen Verunsicherungen, Unterlegenheitsgefühle sowie Zweifel und Kritik, signalisieren aber ebenso ein hohes Pflichtbewusstsein, Verantwortungs-gefühl und Entschlossenheit für den Einsatz.
Die Vorschläge für psychologische Trainingselemente entstanden insbesondere anhand von Trainingsbeobachtungen und den Diskussionen einer Landesarbeitsgruppe, welche aus Einsatztrainern und -trainerinnen sowie Experten des Spezialeinsatzkommandos, des Mobilen Einsatzkommandos, der Bereitschafts- und Festnahmeeinheit, dem Medizinischen und Sozialwissenschaftlichen Dienst der Polizei Niedersachsen bestand.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
2 Der Auftrag
3 Die Studie
3.1 Die Stichprobe
3.2 Das methodisches Vorgehen
3.3 Der halbstrukturierte Interviewleitfaden
4 Ergebnisse
4.1 Motivation der Einsatzkräfte
4.2 Hochstresssituationen
4.3 Empfundene Vorbereitung auf lebensbedrohliche Einsatzlagen
4.4 Erwartete negative Beeinträchtigungen in Hochstresssituationen
4.5 Befinden: Potenzieller eigener Tod
4.6 Der Tod von KollegInnen
4.7 Schusswaffeneinsatz
4.8 Nachbereitung
4.9. Verbesserung der Vorbereitung
5 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der Studie
6 Die praktische psychologische Vorbereitung von Einsatzkräften
6.1 Grundsätze und Methoden für das Einsatztraining LebEl
6.2 Übungsvorschläge
7 Diskussion
8 Schlusswort
Literaturverzeichnis
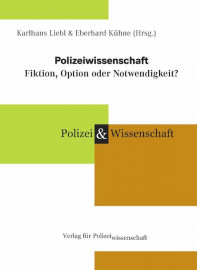
Daraus erwachsen Befürchtungen und Bedenken, dass diese erweiterten Befugnisse nicht vollständig grundrechtskonform sind. In diesem Kontext zeigten das Bundes-verfassungsgericht und die Verfassungsgerichte der Länder zum wiederholten Male die Grenzen gesetzgeberischen Handelns auf.
Welche Bedeutung kommt der Polizeiwissenschaft zu, um diese Entwicklungen erfolg- reich zu gestalten? Fünfzehn Autorinnen und Autoren liefern mit ihren Aufsätzen in diesem Buch Antworten auf diese Frage und kommen zu einem klaren Fazit:
Polizei und Gesellschaft brauchen eine beobachtende, gestaltende und kritisch reflektierende Polizeiwissenschaft, die die Aufgaben der Polizei in der Gesellschaft und die dazu erforderlichen Befugnisse bestimmt.
Die Polizei braucht eine Polizeiwissenschaft, die ihre Kompetenzen stärkt und ihren Ressourcenbedarf begründet.
Die Gesellschaft braucht eine Polizeiwissenschaft, die Effizienz und Angemessenheit polizeilichen Handelns bei Gefahrenabwehr und Strafverfolgung auf wissenschaftlicher Grundlage dem politischen Diskurs zugänglich macht.
Mit diesem Buch wird der aktuelle Stand der Polizeiwissenschaft kritisch reflektiert und es werden die Konturen der zu etablierenden Polizeiwissenschaft her-ausgearbeitet.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
Eberhard Kühne & Karlhans Liebl
Der Stellenwert von Theorien in Zeiten der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz – mit Ausblicken auf die Polizeiwissenschaften und Polizeiausbildung
Anton Sterbling
„Polizeiwissenschaft“ als eigenständige Disziplin – historische Entwicklung und Bedeutung
Martin H. W. Möllers
Polizeiwissenschaft als Ermessens- und Führungslehre.
Skizze eines Kontext-Vergleichs
Rainer Prätorius
Forschung für und bei der Polizei – Vermittlungsoption zwischen Notwendigkeit und Fiktion
Esther Jarchow
Über die Polizei forschen oder mit Polizist*innen reden?
Zwei Perspektiven der Polizeiforschung: Möglichkeiten und Konsequenzen.
Nils Zurawski
Digitale und gesellschaftliche Transformationen.
Polizeiwissenschaft mit Norbert Elias
Oliver Bidlo & Julia Katherina Mahnken
Polizeiwissenschaft als ganzheitliche Sicht auf die Polizei in der demokratischen Gesellschaft
Eberhard Kühne
Polizei - eine Verwaltungsbehörde? Zur Tragikomödie „Darum brauchen wir keine Polizeiwissenschaft“
Karlhans Liebl
Wissen als Herausforderung – Polizeiliches Einsatztraining in systemsicher Perspektive
Swen Körner & Mario S. Staller
Polizeiliches Einsatztraining als Herausforderung für die Wissenschaft – Kommunikative und inhaltliche Aspekte
Mario S. Staller & Swen Körner
Erwartungen eines Praktikers an die Polizeiwissenschaft
Horst Brandt
„Neues“ Polizei- bzw. „Sicherheitsrecht“ in Deutschland - Sicherheitspolitischer „Paradigmenwechsel“ oder gebotene Anpassung an eine elementar veränderte Sicherheitslage?
Holger Plank
Wissensmanagement aus kriminalistischer Perspektive
Ralph Berthel
Wissen, Wissenschaft, Polizeiwissenschaft - eine Betrachtung aktueller Aspekte
Clauss-Siegfried Grommek
Über Normativität und Notwendigkeit - Zur Bedeutung einer ethisch reflektierten Polizeiwissenschaft
Marco Krüger
Mario Staller
„Ich bin nur die Vertretung…“ Gamifizierung in der Psychologie Lehre an einer Hochschule der Polizei
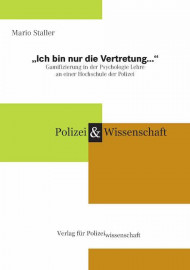
Inhalt
1 Einleitung
2 Game-Design und Hochschullehre
2.1 Vom Spielen in der Hochschullehre
2.2 Game Design: Vom Gestalten eines Lernerlebnisses
2.3 Ein (weiteres) Gamifizierungsframework
3 Gamifizierung und reflexive Pädagogik
3.1 Play, Game, Gamifizierung
3.2 Gamifizierung und Lehre: Potenziale der (Nicht-)Definition
4 Ein gamifiziertes Konzept in der Hochschullehre
4.1 Forschungsziel
4.2 Forschungsdesign
4.3 Kontext des Forschungsprojektes
4.4 Design Prozess (Handlungsplan)
4.4.1 Was – Reflexionen
4.4.2 Wer - Reflexionen
4.4.3 Kontext – Reflexionen
4.4.4 Selbst - Reflexionen
4.4.5 Wie - Reflexionen: Design-Überlegungen
4.5 Datenerhebung
4.5.1 Feldnotizen
4.5.2 Befragung Sommer 2020
4.5.3 Lehrevaluationen 2018/2019
4.5.4 Klausurergebnisse
4.6 Datenanalyse
4.7 Ergebnisse
4.7.1 Positive und negativ wahrgenommene Aspekte
4.7.2 Auswertung der Feldnotizen der Beobachtung
4.7.3 Bewertung der Lehrveranstaltung
4.7.4 Bewertung Klausuren im Studienjahr 2019/2020
4.8 Diskussion
4.8.1 Effektive Lehre vs. Effektive gamifizierte Lehre
4.8.2 Positive Emotionen und positives Engagement
4.8.3 Kritische Aspekte der gamifizierten Lehre
4.8.4 Implikationen und Anpassungen für die künftige Praxis
4.9 Einschränkungen
5 Zusammenfassung
6 Literatur
Julia Katherina Mahnken
Auswirkungen der digitalen Transformation für die Aufgaben und Ausrichtung der Kriminalpolizei Wie die Technikbetroffenheit die Kriminalpolizei verändert – Figurations- und prozesssoziologische Analyse in den Polizeiwissenschaften.
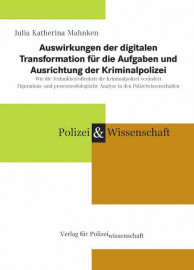
Die Forschungsfrage lautet, wie sich die Aufgaben und Ausrichtung der Kriminalpolizei unter dem Einfluss der digitalen Transformation verändern. Dafür wird in dieser Arbeit die Polizeiwissenschaft genutzt, um eine fr die Organisation und Praxis relevante kriminalstrategische Frage zu beantworten.
Auf der Mikro- und Mesoebene wird polizeiwissenschaftlich synthetisiert, dass durch neue Leitbilder Spannungen unter den Mitarbeitern entstehen, dass das Arbeiten in der Entwicklungsstufe der Digitalisierung demotivierend auf die Mitarbeiter wirkt (die privat in einer digital vernetzten Welt leben), dass transnationale Ermittlungserfordernisse europäische Ermittlungsgrundlagen und Tandem-Teams erfordern und dass die nationale Gesetzgebung in ihrer jetzigen Form zunehmend zu langsam für die Rasanz der digitalen Transformation werden wird. Auf der Makroebene wird am Ende sichtbar, dass das starke repressive Streben nach Europa eines kräftigen Gegengewichts auf regionaler Ebene bedarf, damit die Kriminalpolizei ihre (die Gesellschaft stabilisierende) Funktion weiterhin erfüllt.
Aufbauend auf den Ergebnissen verbinden sich Wissenschaft und Praxis, indem der kriminalstrategische Teil der Forschungsfrage zur künftigen Ausrichtung der Kriminalpolizei beantwortet wird. Wie kann ein neues kriminalpolizeiliches Selbstverständnis aussehen? An welchem Sinn könnte es sich orientieren und welche gesellschaftliche Funktion könnte es erfüllen?
Am Ende bleibt festzuhalten, dass sich figurations- und prozesssoziologische Methoden eignen, die in den Polizeien anstehenden Transformationsprozesse fortlaufend interdisziplinär zu begleitforschen, um die Organisation Polizei bei den anstehenden Transformationsprozessen lösungsorientiert zu unterstützen, aufzuzeigen, warum es gerade wo hakt, wer hinterherhinkt und um fortlaufende organisationsbezogene Anpassungsbedarfe sichtbar zu machen. Die Untersuchung veranschaulicht, dass polizeiwissenschaftlich dringend Handlungs- und Forschungsbedarf im Themenfeld „Digitale Transformation und ihr Wirken“ besteht.
Inhalt
I. Inhalt
II. Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1.Themendarstellung
1.2.Methodik
1.3.Erweiterung der Forschungsfrage
1.4.Vorgehen
2. Theoretischer und methodischer Rahmen
2.1.Einführung in die Figurations- und Prozesssoziologie
2.1.1.Die Dynamik sozialer Prozesse und die Ordnung des Wandels
2.1.2.Das begriffliche Werkzeug der Figuration
2.1.3.Affektive Bindungen
2.1.4.Verflechtungen, Interdependenzen und Machtbalancen
2.1.5.Zivilisationstheorie (Sozio- und Psychogenese)
2.1.6.Staatsbildungsprozesse, Wir- und Ich-Identitäten
2.1.7.Das Modell der Triade der Grundkontrollen
2.1.8.Kritik und Einordnung
2.1.9.Prüfung der Relevanz in Bezug auf die Forschungsfrage
2.2.Transfer und Entwicklung des methodischen Vorgehens
3. Veränderte (Arbeits-)Welt: Digitale Transformation
3.1.Digitalisierung und sozialer Wandel
3.2.Digitale Reifeprozesse
3.3.Digitale Transformation und Organisationen
3.4.Technik und Zivilisation bei Norbert Elias
3.5.Zwischenergebnisse: neue Märkte und der Mensch als Zahl
4. Analyse der Figuration Kriminalpolizei
4.1.Gewordensein: Die Entwicklung zu einer eigenständigen Einheit
4.2.Aufgaben der Kriminalpolizei: Status quo
4.3.Ausrichtung der Kriminalpolizei
4.4.Neue Herausforderung: Komplexität fordert Öffnung und Agilität
4.5.Zwischenergebnisse: ganzheitlich statt präventiv oder repressiv
5. Analyse der Technikbetroffenheit der Kriminalpolizei
5.1.Innerhalb der Figuration
5.1.1.Zwischenergebnisse: Spannungen aufgrund gegensätzlicher Entwicklungen (privat vs. Beruf) und verschobener Machtbalancen
5.2.Veränderungen in der Außenwirkung: Fallbeispiel „Kellereinbruch“
5.2.1.Zwischenergebnisse: Entgrenzte Bürger und nationalstaatlich begrenzte Kriminalermittelnde (von der anordnenden zur Hilfe annehmenden Partei)
5.3.Veränderungen in den Ermittlungen: Fallvergleich „Drogenhandel“
5.3.1.Zwischenergebnisse: Veränderte Marktmöglichkeiten und veränderte Täterstrukturen führen zu neuen Ermittlungsmöglichkeiten und erfordern kriminalstrategische und strukturelle Anpassungen
5.4.Analyse veränderter Interdependenzen in der Gewaltenteilung
5.4.1.Zwischenergebnisse: Ausdehnung der kriminalpolizeilichen Ermittlungen in Europa und legislativ bedingte Asymmetrie
5.5.Mikro- und Makrozusammenhänge: Wo entstehen Spannungen?
5.5.1.Zwischenergebnisse: Grenzen des nationalstaatlichen Gewaltmonopols und Bedarf disruptiver Veränderungen
6. Essenzen und eigene Synthesen
6.1. Notwendige Anpassungsbedarfe
6.2. Dimensionale Erweiterung der Kriminalistik
7. Diskussion, Fazit und Ausblick
III. Anlagen
Christian Cernak
Digital Community Policing im Kontext sozialer Medien Herausforderungen und Einflussfaktoren aus organisations-, führungs- und mitarbeiterzentrierter Sicht
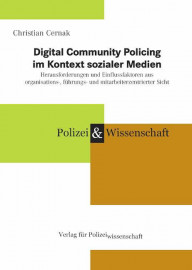
Diese Forschungsarbeit befasst sich mit den Herausforderungen und Einflussfaktoren bei der Implementierung von Digital Community Policing bei der Polizei Niedersachen. Dabei werden über die Methoden einer Gruppendiskussion auf operativer Ebene sowie vier Experteninterviews auf strategischer Ebene die Bezüge zum Change Management und dem Einfluss von Veränderungs- und Führungskäftekommunikation auf den Wandel sowie die Wichtigkeit der Aspekte Organisations-, Vertrauens- und Fehlerkultur und der Führung hergestellt. Insbesondere ist das Konzept des Digital Community Policing auch für alle anderen Länderpolizeien der BRD geeignet, so dass die in dieser Arbeit erforschten Aspekte auch dort eine Relevanz entfalten dürften.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
1.1 Thematische Einführung
1.2 Erkenntnisinteresse und Abgrenzung
1.3 Aufbau der Arbeit
2 Theoretische Grundlagen und Stand der Forschung
2.1 Mediennutzungsverhalten in Deutschland
2.2 Nutzung Sozialer Medien durch die Polizeien der Länder und des Bundes
2.3 Community Policing
2.4 Digital Community Policing im Allgemeinen und bei der Polizei NI
2.5 Change Management und der Einfluss von Veränderungs- und Führungskräftekommunikation auf den Wandel
2.6 Führung
2.7 Organisationskultur
2.8 Vertrauens- und Fehlerkultur in einer Organisation
2.9 Zwischenfazit
3 Theoretisch fundierte Fragestellungen
4 Methodik
4.1 Empirischer Forschungsprozess
4.2 Forschungsdesign
4.3 Forschungsmethoden: Leitfadengestützte Gruppendiskussion und Experteninterviews
4.4 Qualitative Inhaltsanalyse
4.5 Kritische Auseinandersetzung mit der Methodik
5 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
5.1 Bedeutung von sozialen Medien und DCP für die Polizei NI
5.2 Bewertung der Organisationskultur
5.3 Einfluss von Strategien
5.4 Einfluss von Führung und Führungskräftekommunikation auf den Veränderungsprozess
5.5 Herausforderungen Change Management und Veränderungskommunikation
5.6 Bedeutung von Vertrauen und Status der Fehlerkultur
6 Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse und ihre Diskussion
6.1 Wesentliche Erkenntnisse
6.2 Empfehlungen
6.3 Grenzen der Untersuchung und Forschungsansätze
6.4 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
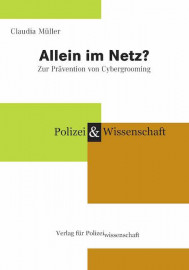
Inhalt
Inhalt:
1. EINLEITUNG
2. FORSCHUNGSFRAGE
3. METHODIK
4. DAS PHÄNOMEN CYBERGROOMING
4.1 DEFINITION
4.2 ONLINE-SPIELE UND CYBERGROOMING
4.3 DIE PHÄNOMENOLOGIE DES CYBERGROOMING
4.4 TÄTERTYPOLOGIE
4.5 VIKTIMOLOGIE
4.6 KRIMINOLOGISCHE ERKLÄRUNGSANSÄTZE
4.7 MATERIELLES STRAFRECHT
4.8 CYBERGROOMING IM HELLFELD
4.9 CYBERGROOMING IM DUNKELFELD
5. DAS AKTUELLE BEISPIEL FORTNITE: BATTLE ROYALE
5.1 ALLGEMEINES
5.2 NUTZUNGSVERHALTEN
6. ZWISCHENERGEBNIS
7. BESTEHENDE PRÄVENTIVE MAßNAHMEN
7.1 ALLGEMEINES
7.2 UNIVERSELLE KRIMINALPRÄVENTION
7.3 SELEKTIVE
7.4 INDIZIERTE KRIMINALPRÄVENTION
8. ZWISCHENERGEBNIS
9. ANSÄTZE FÜR WEITERE MÖGLICHKEITEN DER PRÄVENTION
9.1 UNIVERSELLE KRIMINALPRÄVENTION
9.2 SELEKTIVE KRIMINALPRÄVENTION
9.3 INDIZIERTE KRIMINALPRÄVENTION
10. FAZIT
LITERATURVERZEICHNIS
Christoph Gusy und Jan-Peter Möhle, Marcus Kutscher, Julia Merdian, Jonas Blaszkowski, Ksenia Dick, Merle Fock, Alina Kulle, Lilith Boos, Natascha Nortz
Informationsrechte und -pflichten kinder- und jugendbetreuender Stellen gegenüber der Polizei Vom institutionellen und informationellen Nebeneinander zur limitierten Kooperation
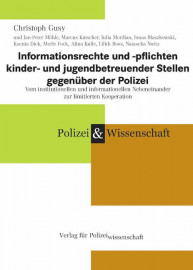
Inhalt
Inhalt:
I. Fragestellung
II. Schutzgüter des Geheimnisschutzes: Vielfalt der Rechtsgrundlagen – Vielfalt der Inhalte
1. Datenschutzgrundverordnung1 und Richtlinie zur Zusammenarbeit von Sicherheits- u.a. -behörden (JI-Richtlinie)
2. Privatgeheimnisschutz durch berufsbezogene Schweigepflichten
a) Der Schutz von „Privatgeheimnissen“ in § 203 StGB
b) Schweigepflichten aus Berufsordnungen freier Berufe
c) Auskunfts- und Zeugnisverweigerungsrechte im Prozess – Das Beispiel der §§ 52 ff StPO
3. Arbeits- und dienstrechtliche Verschwiegenheitspflichten
4. Zusammenfassung: Informationsrecht ist maßgeblich
III. Informationsrechtliche Grundlagen: Anwendbarkeit, Anforderungen und Grenzen
1. Sozialrechtliche Rechtsgrundlagen
2. Einige Schlüsselbegriffe: Anwendbarkeit von Sozialrecht, personenbezogene Informationen, Sozialdaten
3. Zusammenarbeit als Ausgestaltung und Grenze des Persönlichkeitsrechts
4. Zur Bedeutung der polizei- und sicherheitsrechtlichen Informationsrechte
IV. Einzelne Übermittlungsbefugnisse und -grenzen
1. Strafrechtliche Anzeige- und Garantenpflichten
a) Nichtanzeige geplanter Straftaten
b) Strafrechtliche Garanten- und Hilfeleistungspflichten
2. Informationsrechte und -pflichten als Grenzen des (Sozial-) Geheimnisschutzes: SGB I, X als allgemeiner Ausgangspunkt
3. Von der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe zum Kinderschutz: § 8a SGB VIII
a) Grundgedanken des Gesetzes: Subsidiarität, Information, Kooperation
b) Informations- und Verfahrenspflichten der betreuenden Stellen
c) Effektivität durch Verfahren, nicht Verfahren statt Effektivität
4. Das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
5. Der strafrechtliche Notstand (§ 34 StGB) als subsidiärer Auffangtatbestand für Informationsweitergabe
a) Allgemeine Anforderungen des Notstandsgedankens (am Beispiel des § 34 StGB)
b) Anwendbarkeit des Notstandsgedankens im SGB VIII?
c) § 34 StGB als Ermächtigungsnorm für Datenübermittlung?
d) Zusammenfassung zu § 34 StGB
V. Das Informationsrecht als Abwägungsauftrag und -rahmen
1. Materiell-rechtliche Vorgaben
2. Prozedurale Vorgaben: Rechtsverwirklichung durch Verfahren
VI. Zusammenfassung: Übermittlungspflichten und Schweigerechte im Verfahren
1. Materielle Determinanten des Schutzes von Kindern und Jugendlichen
2. Die Vorentscheidung: Normalfall oder Eilfall?
3. Der rechtliche Regelfall: Entscheidungsrichtigkeit durch Verfahren
a) Fach- und sachkundige Risikoabschätzung als Grundlage
b) Von der Faktenfeststellung zur Entscheidung: Verfahren als Rückkopplungs- und Kontrollprozess
4. Der rechtliche Ausnahmefall: Entscheidungsrichtigkeit bei „Gefahr im Verzug“
VII. Abschließende Feststellung: Vom Nebeneinander zum limitierten Miteinander von Jugendhilfe und Polizei