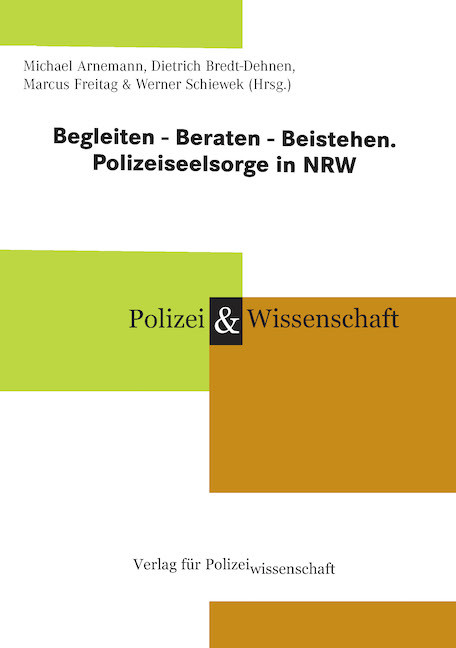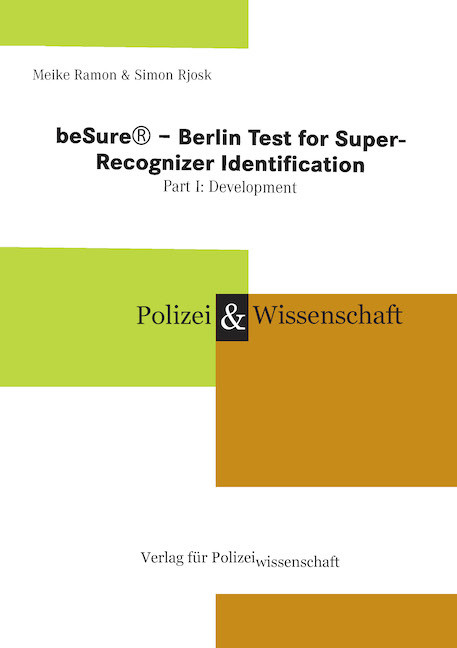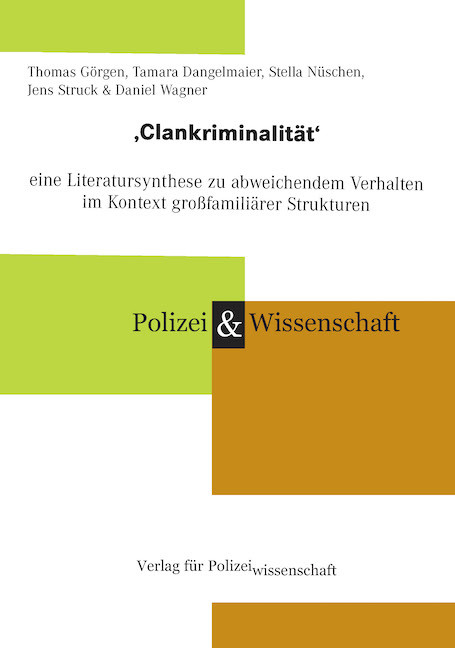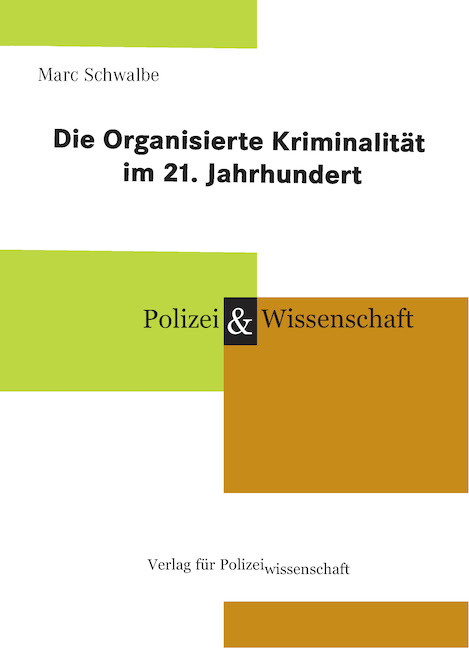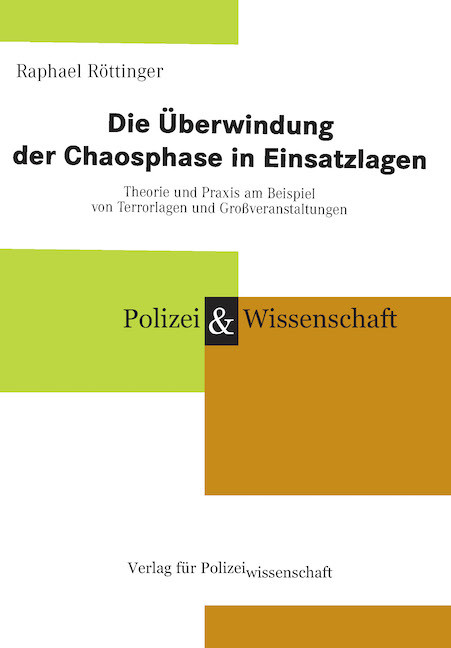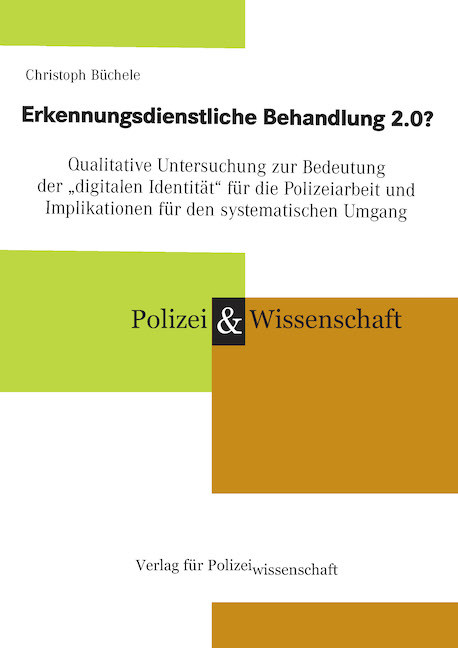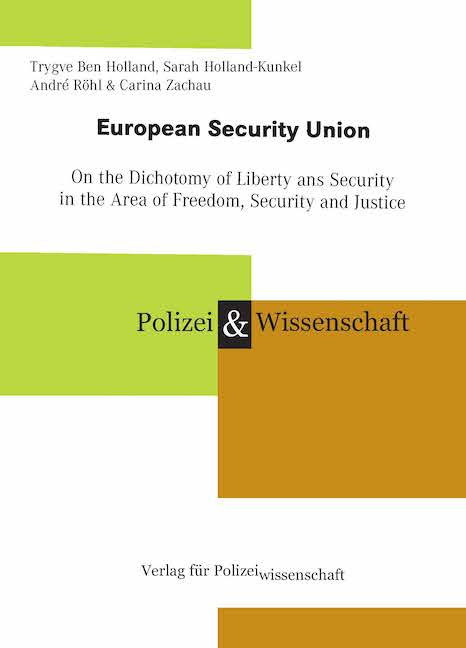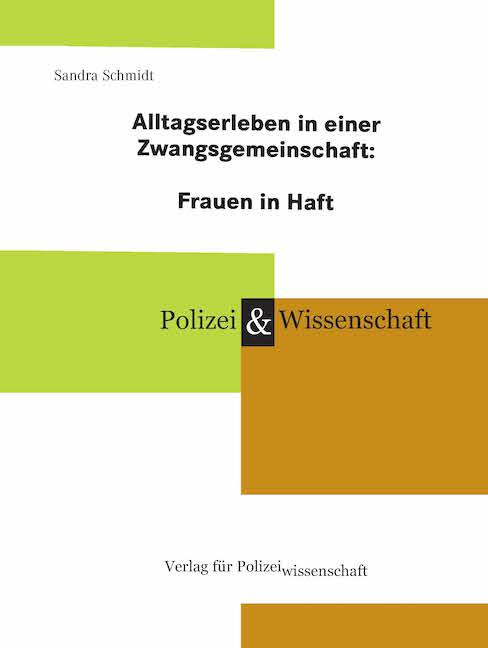Michael Arnemann, Dietrich Bredt-Dehnen, Marcus Freitag, Werner Schiewek (Hrsg.)
Begleiten - Beraten - Beistehen. Polizeiseelsorge in NRW
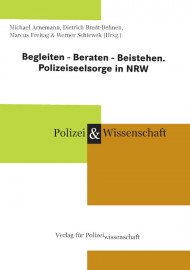
Dieser Band gewährt einen aktuellen Einblick in die Arbeit der Polizeiseelsorge in Nordrhein-Westfalen. Hintergründe und Arbeitsbereiche werden dargestellt, persönliche Erfahrungen finden sich ebenso wie grundsätzliche Überlegungen zur Polizeiseelsorge heute.
Inhalt
Inhalt:
Grußwort
Vorwort
I. Grundlagen der Polizeiseelsorge
1. Wozu Polizeiseelsorge? Grundsätzliche Überlegungen zum Engagement der Kirchen in der Polizei
Werner Schiewek
2. „Aus der Nische mitten ins Herz.“ Zum Selbstverständnis der Polizeiseelsorge im Kontext der Organisation Polizei NRW
Dietrich Bredt-Dehnen
3. Der Dienst am Recht – als Auftrag der Kirchen für die Menschen in der Polizei.
(Pastoral-)Historische Aspekte zu sechzig Jahren Polizeiseelsorge (1962-2022)
Michael Arnemann
4. Vertraglich besiegeltes Vertrauen – 60 Jahre Polizeiseelsorge in Nordrhein-Westfalen
Markus Schulten
II. Arbeitsbereiche der Polizeiseelsorge
1. Seelsorge
5. Seelsorge
Judith Palm
6. Was mache ich hier eigentlich? Betrachtungen eines Polizeiseelsorgers. Ein Erfahrungsbericht
Nobert Schmitz
7. Online-Beratung in der Polizeiseelsorge – Ein Beitrag zur zukünftigen „Anschlussfähigkeit“
Volker Hülsdonk
8. Seelsorge an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW)
Judith Palm
2. Spiritualität
9. Leben braucht Segen: Segensfeiern als Handlungsfeld der Polizeiseelsorge
Astrid Jöxen
10. Polizeiseelsorge und Gottesdienste
Johannes Gospos
11. Einmal auftanken, bitte! Spirituelle Auszeiten für Polizeibeamt:innen
Martin Dautzenberg, Lydia Bröß
12. Gedenken als heilsame Momente
Stefanie Alkier-Karweick
13. Manchmal muss man einfach an die frische Luft …
Vom Wallfahren und spirituellen Unterwegssein mit der Polizeiseelsorge
Dominik Schultheis
14. „Atem holen für die Seele“ – Stilleseminare
Judith Palm
3. Begleitung
15. „Sind Sie der Bestatter?“ – Polizeiseelsorge in Begleitung von Einsatzlagen
Wolfgang Bender
16. „Das könnte ich nie.“ Begleitung von Polizeibeschäftigten im Bereich Bekämpfung von sog. „Kinderpornografie“
Dietrich Bredt-Dehnen
17. Der tödliche Schuss und seine Folgen. Seminar zur Nachsorge bei Schusswaffengebrauch
Martin Dautzenberg, Burkhard Müller
18. AusWegLos? Suizid in den eigenen Reihen
Dietrich Bredt-Dehnen, Marcus Freitag
19. Land unter. Polizeiseelsorge angesichts von Großschadenslagen
Claudia Heinemann
4. Berufsethik
20. Ethik als Problem, Tun und Thema der Polizeiseelsorgenden
Tobias Trappe
21. Einsatz der Polizei bei Szenarien mit sofortigem polizeilichen Interventionserfordernis: Amok-TE
Rainer Dürscheid, Monika Weinmann
22. Polizeiliches Handeln bedenken – als Grenzgang.
Idee und Entwicklung neuer Modelle ethischer Bildung für die Polizei NRW
Michael Arnemann
23. Das Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge der Polizei NRW (ZeBuS)
Johannes Gospos
24. Von „Schaden kann’s nicht“ bis zum ZeBuS als „das ethische Rückgrat unserer Polizei“
Stefanie Alkier-Karweick
5. Beratung
25. Wechselwirkungen: Nachdenken über Supervision und Seelsorge in der Polizei
Marcus Freitag
26. Alltagsreflexion
Stephan Draheim
27. Berufsrollenreflexion
Marcus Freitag, Bernd Malecki
III. Anhang
28. Die Texte der Vereinbarung über die Wahrnehmung der evangelischen bzw. katholischen Polizeiseelsorge im Lande Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 1962
29. Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Meike Ramon & Simon Rjosk
beSureⓇ – Berlin Test for Super-Recognizer Identification Part I: Development
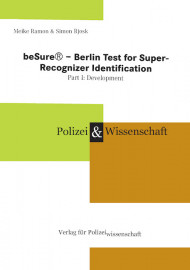
the registered trademark beSureⓇ and the experience gained in its context. The present
report describes the context in which beSureⓇ emerged, as well as its development - from
ideation to technical design, up to experimental implementation. On the one hand, this
report aims to provide interested practitioners and researchers with information, which is
both exhaustive and understandable for readers from all backgrounds. On the other hand,
this report also provides methodological documentation required for reproduction and
replication of the procedures of beSureⓇ.
Inhalt
Inhalt:
Prologue
Acknowledgements
Author Biographies
1. Introduction
1.1. Background
1.1.1. What is Face Identity Processing?
1.1.2. Super-Recognizers: Individuals Originally Discovered in the Lab
1.1.3. Super-Recognizers for Policing?
1.2. Assignment LKA Berlin: (How) can we detect Super-Recognizers within the Berlin Police?
2. Description of the Development of beSureⓇ
2.1. Task Analysis via Expert interviews
2.1.1. Interviewed Expert Units
2.1.2. Outcome of the Task Analysis
2.1.3. Implications of the Task Analysis for beSureⓇ
2.2. Material preparation
2.2.1. Source databases (LVD, Fahndungsbilder, Videos von LKA 645)
2.2.2. Challenges
2.2.3. Stimulus selection
3. beSureⓇ
3.1. Subtests of beSureⓇ
3.1.1 Constrained Static Material: Mugshot Images
3.1.2. Unconstrained Static Material: Wild Images
3.1.3. Unconstrained Dynamic Material: Wild Videos
3.2. Technical Implementation of beSureⓇ
4. Legal Considerations Specific to the Initial beSureⓇ Roll-Out and Implications for Future Deployment
4.1. Berlin Data Protection Office Requirements
4.2. Measures Implemented to Meet the Berlin Data Protection Office Requirements
5. Conclusion and Outlook
6. References
Prolog
Danksagungen
Authorenbiographien
1. Einleitung
1.1. Hintergrund
1.1.1. Was ist Gesichtsidentitätsverarbeitung?
1.1.2. Super-Recognizer: Personen, die ursprünglich im Labor identifiziert wurden
1.1.3. Super-Recognizer im Polizeieinsatz?
1.2. Auftrag des LKA Berlin: (wie) können wir Super-Recognizer innerhalb der Polizei Berlin identifizieren?
2. Beschreibung der Entwicklung von beSureⓇ
2.1. Aufgabenanalyse durch Experteninterviews
2.1.1. Interviewte Expert*innen
2.1.2. Ergebnis der Aufgabenanalyse
2.1.3. Implikationen der Aufgabenanalyse für beSureⓇ
2.2. Materialaufbereitung
2.2.1. Datenbanken (LVD, Fahndungsbilder, Videos von LKA 645)
2.2.2. Herausforderungen
2.2.3. Stimulusauswahl
3. beSureⓇ
3.1. Subtests von beSureⓇ
3.1.1 Standardisiertes statisches Material: ED-Bilder
3.1.2. Unkontrolliertes statisches Material: “Wilde Lichtbilder”
3.1.3. Unkontrolliertes dynamisches Material: “Wilde Videos”
3.2. Technische Implementierung von beSureⓇ
4. Legale Erwägungen bzgl. der Einführung und künftigen Umsetzung von beSureⓇ
4.1. Anforderungen der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
4.2. Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen der Berliner Datenschutzbeauftragten
5. Ausblick
6. Literaturverzeichnis
Thomas Görgen, Tamara Dangelmaier, Stella Nüschen, Jens Struck & Daniel Wagner
‚Clankriminalität‘ Eine Literatursynthese zu abweichendem Verhalten im Kontext großfamiliärer Strukturen
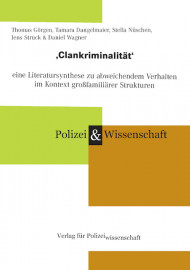
Inhalt
Inhalt:
1. Einleitung
2. Methode und Überblick zu den Einschlusskriterien sowie der herangezogenen Literatur
3. Befunde zur ‚Clankriminalität‘
3.1. Befunde zur Phänomenologie von ‚Clankriminalität‘
3.2. Befunde zur Genese, zu Entstehungs- und Aufrechterhaltungsbedingungen von ‚Clankriminalität‘
3.3. Befunde zum gesellschaftlichen und kriminalpolitischen Umgang mit ‚Clankriminalität‘
4. Fazit
Literatur
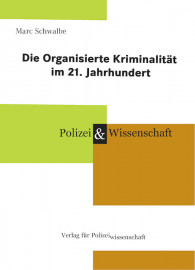
Die Organisierte Kriminalität ist ein Phänomen, welches sich insbesondere durch eine schnelle Anpassungsfähigkeit an neue Gegebenheiten auszeichnet. Die in Deutschland Anfang der 1990er Jahre von der GAG Polizei/Justiz entwickelte OK-Definition ist mittlerweile über 30 Jahre alt und hat die in dieser Zeit massiven gesellschaftlichen Veränderungen überdauert. Vor diesem Hintergrund ist die Frage zu stellen, ob die alte OK-Definition das Phänomen „Organisierte Kriminalität“ überhaupt noch in seiner Gänze erfassen kann. Im vorliegenden Buch wird dieser Frage holistisch auf den Grund gegangen, wobei auch die diesbezüglichen und bereits vorhandenen Erkenntnisse aus der Wissenschaft zusammengeführt werden. Am Ende steht eine (Neu-) Definition der Organisierten Kriminalität, welche aktuellere Phänomene, wie z.B. die Cyber-OK und ihre Besonderheiten, zu umfassen versucht. Aber auch zukünftig wird es unabdingbar sein, die OK-Definition in gewissen Zeitabständen an der Realität zu messen, was dann durch OK-Expert*innen, OK-Gremien, usw. initiiert und durchgeführt werden sollte.
Inhalt
Inhalt:
1. Einleitung
1.1 Thematische Einführung
1.2 Untersuchungsfragestellung und Methodik
2. Eine Chronik der Organisierten Kriminalität
2.1 Organisierte Kriminalität im Ausland
2.2 Zusammenfassung
2.3 Organisierte Kriminalität in Deutschland
3. Betrachtung der OK-Indikatoren
3.1 Analyse
3.2 Untersuchung der Indikatoren
4. Resümee
5. Holistische Analyse
5.1 Definitionstheorien in nuce
5.2 Globale Ansätze
5.3 Ansätze in Deutschland
6. OK-Definition - Quo vadis?
6.1 Entstehung des OK-Begriffs
6.2 Intention der OK-Definition
6.3 Zweifel an der OK-Definition
6.4 Unterscheidung von der Bande
6.5 Unterscheidung von der kriminellen Vereinigung
6.6 Zweckmäßigkeit einer OK-Definition
6.7 OK-Definitionsversuch im Lichte der Cyber-OK
7. Schlussbetrachtung
7.1 Diskussion
7.2 Fazit
Quellen- und Literaturverzeichnis
Raphael Röttinger
Die Überwindung der Chaosphase in Einsatzlagen Theorie und Praxis am Beispiel von Terrorlagen und Großveranstaltungen
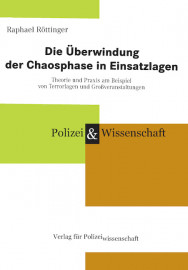
Inhalt
Inhalt:
1. Die Krise überwinden - Einsätze in außergewöhnlichen Lagen
1.1 Fragestellung
1.2 Methodik und Vorgehensweise
2. Die Besonderheiten von Einsätzen in Krisenlagen
2.1 Überblick
2.2 Taktische Ziele
2.3 Lagebild
2.4 Die Chaosphase als Beginn des Einsatzes
3. Kritische Elemente in Krisensituationen: Das Führungssystem und die Stabsarbeit
3.1 Führungsorganisation
3.2 Führungsvorgang
3.3 Stabsarbeit und -organisation
4. Die Chaosphase bei Großveranstaltungen - Antizipation und Vorbereitung
4.1 Fallbeispiel: G20-Gipfeltreffen in Hamburg am 7. und 8. Juli 2017.
4.2 Die Notwendigkeit programmierter Entscheidungen
4.3 Die Rolle des Vorbereitungsstabs
5. Die Chaosphase bei Terrorlagen – Das Unkontrollierbare kontrollieren
5.1 Fallbeispiel: Terroranschlag am 9. Oktober 2019 in Halle (Saale)
5.2 Führen unter Informationsmangel
5.3 Kontrolle der Lage durch Informationen und Führungsstrukturen
5.4 Koordination in Sofortlagen - Die Handlungsfelder Einsatz & Planung
5.5 Flexible Stäbe
6. Vergleichende Analyse - Überwindung der Chaosphase in Krisensituationen
6.1 Zeitliche Dimension
6.2 Führungsstruktur
6.3 Ablauf
6.4 Arbeitsaufwand
7. Schlussfolgerung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Christoph Büchele
Erkennungsdienstliche Behandlung 2.0? Qualitative Untersuchung zur Bedeutung der „digitalen Identität“ für die Polizeiarbeit und Implikationen für den systematischen Umgang
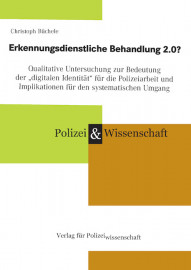
Jeder Internetnutzende verfügt heute über eine Vielzahl unterschiedlicher Benutzerkonten sei es in sozialen Netzwerken, beim E-Commerce, für Zahlungsleistungen oder schlicht die E-Mailadresse. Damit Menschen in der virtuellen Welt identifizierbar werden und interagieren können, sind diese digitalen Identitäten als Grundlage notwendig. Gleichzeitig werden sie auch vermehrt für kriminelle Zwecke von Beleidigungen bis hin zu Cybercrime missbraucht. Die Polizei ist demnach gezwungen, mit digitalen Identitäten umzugehen, um ihren ureigensten Aufgaben gerecht zu werden.
Im Rahmen dieser Veröffentlichung wird der aktuelle Umgang mit digitalen Identitäten im polizeilichen Kontext sowie Implikationen für die Zukunft dargestellt. Angefangen bei den Grundlagen der Digitalisierung beleuchtet der Autor ausführlich den Begriff der digitalen Identität und stellt deren Bedeutung in der heutigen Lebenswirklichkeit dar. Daran knüpft eine intensive Analyse der Relevanz der digitalen Identität für die Kriminalität an.
Die Polizei hat sich der Thematik pragmatisch angenommen, unter anderem mit den ebenfalls dargestellten OSINT-Recherchen. In der Arbeit wird jedoch diskutiert, inwiefern dies die Bedeutung für die heutige Polizeiarbeit hinreichend abdeckt. Dazu wird das bestehende begrenzte Hilfskonstrukt zur Speicherung digitaler Identitätsdaten aufgedeckt und die funktionellen, organisatorischen und rechtlichen Problemstellungen, welche sich dadurch aufwerfen, thematisiert. Die Veröffentlichung greift die bestehenden Missstände auf und folgert, dass zukünftige Polizeiarbeit in der Lage sein muss, in den eigenen Systemen digitale Identitäten erfassen und verarbeiten zu können. Als Lösungsgrundlage dafür wird die ED-Behandlung 2.0 vorgestellt. Die Arbeit zeigt die notwendigen Rahmenbedingungen auf, insbesondere die Bedürfnisse und Anforderungen der Praxis und beleuchtet eventuelle Alternativen.
Die dem Buch zugrundeliegende Masterarbeit wurde im Jahr 2021 mit dem „Zukunftspreis Polizeiarbeit“ (Behörden Spiegel) und dem „Preis der Stüllenberg Stiftung“ (Deutsche Hochschule der Polizei) ausgezeichnet.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung: Identität im Internet - ein Zukunftsthema erfasst die Gegenwart
1.1 Thematische Hinführung: Digitale Identität als ein Thema im polizeilichen Tätigkeitsfeld?
1.2 Struktur und Inhalt der Arbeit
2 Begriffsbestimmungen
2.1 Digitalisierung: Ein bestimmendes Phänomen dieser Zeit
2.2 Digitale Identität: Definition erfordert mehrere Blickwinkel
2.3 Erkennungsdienstliche Behandlung: Ein Mittel zur Sicherung physischer Identitäten
2.4 Polizeiliche IT: Vorgangsbearbeitungs-, Fallbearbeitungs- und Informationssysteme
2.5 Abgrenzung rechtlicher und technischer Detailfragestellungen
3 Forschungsstand: Was ist digitale Identität?
3.1 Grundfunktionen der digitalen Identität
3.2 Digitale Identität als Reputation und deren Ursprung
3.3 Digitale Identität als Selbstausdruck und deren Vermessung
3.4 Definition der digitalen Identität anhand ihrer Grundfunktionen
4 Bestandsanalyse: Digitale Identität im polizeilichen Aufgabenbereich
4.1 Schematische Erarbeitung: Digitale Identität und Kriminalität
4.2 Identitätsmissbrauch: Digitale Identität im Fadenkreuz der Kriminalität
4.3 Digitale Identität als Ermittlungshilfsmittel
5 Zwischenfazit: Digitale Identität prägend für die aktuelle Kriminalitätswirklichkeit – Suche nach einer adäquaten Antwort
6 Erläuterung der wissenschaftlichen Methoden
6.1 Übersicht und Kurzerläuterung
6.2 Experteninterview
7 Darstellung der Untersuchungsergebnisse
7.1 Einleitende Fragen bestätigen Expertenstatus
7.2 Einblick in die polizeiliche Praxis: Uneinheitliches Begriffsverständnis und Herausforderungen durch digitale Spuren
7.3 Erhebung der aktuellen Situation: Konkreter Umgang der Polizei mit digitalen Identitätsmerkmalen und auftretende Probleme
7.4 Analyse der Sinnhaftigkeit und der potenziellen Auswirkungen einer Speicherung digitaler Identitätsdaten
7.5 Anregungen aus der Praxis zur Ausgestaltung der Speicherungsmöglichkeit: So niederschwellig wie möglich, so komplex wie nötig
8 Diskussion und Einschätzung der Ergebnisse
8.1 Beurteilung des aktuellen Stands: Vorhandene polizeiliche Möglichkeiten werden der Bedeutung digitaler Identität nicht gerecht
8.2 Zeitgemäßes Werkzeug der Polizei: Die ED-Behandlung 2.0
8.3 Prüfung von Alternativen: Externe Dienstleister schießen über das Ziel hinaus
8.4 Kritische Betrachtung der Ergebnisse
9 Fazit: Die ED-Behandlung 2.0 als wesentlicher Baustein zeitgemäßer Polizeiarbeit
9.1 Zusammenfassung und Ergebnisübersicht
9.2 Schlussfolgerungen: Das Heft des Handelns liegt (noch) bei der Polizei
Nachwort
Trygve Ben Holland, Sarah Holland-Kunkel, André Röhl & Carina Zachau
European Security Union On the Dichotomy of Liberty and Security in the Area of Freedom, Security and Justice
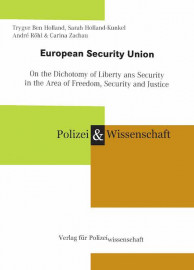
Present book addresses the concepts, policies, programmes, legislative measures and institutions constituting the Area of Freedom, Security and Justice – with emphasis on the protection of civil liberties, namely fundamental rights, and liberal democratic values against the background of Human Rights.
To work on this multi-layered dichotomy – liberty and security, or vice versa, – has been the idea when conceptualising the project ERUPT (European Rights and Union Protection Tools) as a Jean Monnet Module under the ERASMUS+ programme of the EU.
Inhalt
Inhalt:
1 Concept of Unions and Communities
1.1 Competences and Typology
1.2 Enhanced Cooperation
1.3 Security Union
1.4 Common Security and Defence Policy
2 Scope of Fundamental Rights Protection
2.1 Values
2.2 CFR
2.3 ECHR
2.4 Relation of Fundamental Rights to Human Rights, the Internal Market, and the AFSJ
2.5 Binding Effect
2.6 Relation to Domestic Provisions
2.7 CoE, EU, and the Courts
3 Material Scope of (not only) Citizens' Rights
3.1 Of People s Rights and Citizens Rights
3.2 Provisions of the CFR
3.3 Provisions of the TFEU
3.4 Non-discrimination under the TFEU
3.5 Impacts on the AFSJ
4 Area of Freedom, Security and Justice
4.1 Internal and External Dimension
4.2 Cooperation in Criminal Matters
4.3 Law Enforcement Cooperation
4.4 Border Dimension
4.5 Relations to International Organisations
4.6 Mandate
4.7 Policy Areas
4.8 Mandate of Europol
5 Putting the Security Union to Practice
5.1 Security Strategy and Programmes
5.2 Policy Cycles
5.3 Institutions and Mechanisms
5.4 Instruments
5.5 IT Tools
5.6 Prüm Convention
5.7 EEAS and the AFSJ, and beyond to come
5.8 Bilateral Cooperation

Eine explorative Untersuchung zu subkulturellen Erscheinungsformen im Kontext ihrer Entstehungsbedingungen im Frauenstrafvollzug am Beispiel der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta/NI.
Inhalt
Inhalt:
Einleitung und Problemaufriss
1 Kapitel – Theoretischer Bezugsrahmen
1.1 Begriffsbestimmungen und Grundlagen
1.2 Forschungsstand zur Gefangenenkultur
1.3 Fragestellungen der Studie in der JVAfF
2 Kapitel – Methodologische Positionierung und methodische Zugänge
2.1 Auswahl der JVAfF als Erhebungsanstalt
2.2 Gefangenenpopulation der JVAfF zum Zeitpunkt der Studie
2.3 Interviewstudie
3 Kapitel – Untersuchungsergebnisse und Interpretation
3.1 Vorbemerkungen
3.2 Erste Relevanzsetzungen der Gesprächspartnerinnen
3.3 Situation (Teil I) – Die persönliche Situation der inhaftierten Frauen
3.4 Situation (Teil II) – Das Zusammenleben der inhaftierten Frauen
3.5 Schmerzen der Haft (Teil I) – Die ersten Tage in Gefangenschaft
3.6 Schmerzen der Haft (Teil II) – Prisonierungsprozess
3.7 Folge bzw. Reaktion – Das Unterleben im Frauengefängnis
4 Kapitel – Zusammenfassung der Kernbefunde und Handlungsempfehlungen
4.1 Zentrale Ergebnisse der Untersuchung
4.2 Gefängnisinsassinnenkultur-Mosaik
4.3 Methodendiskussion und Limitierungen der Studie
4.4 Kriminalpolitische Überlegungen und Schlussfolgerungen
Fazit