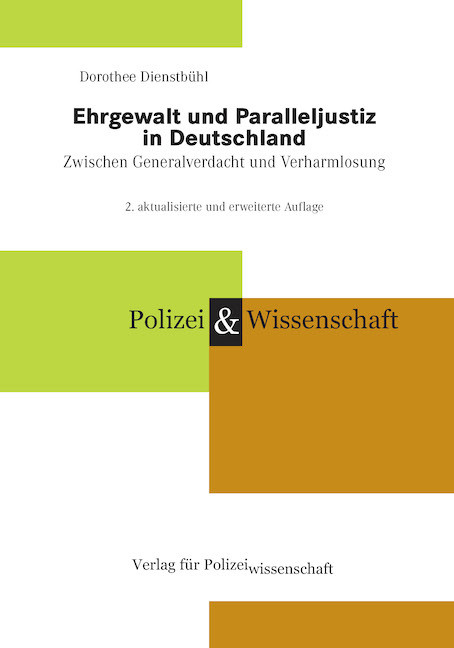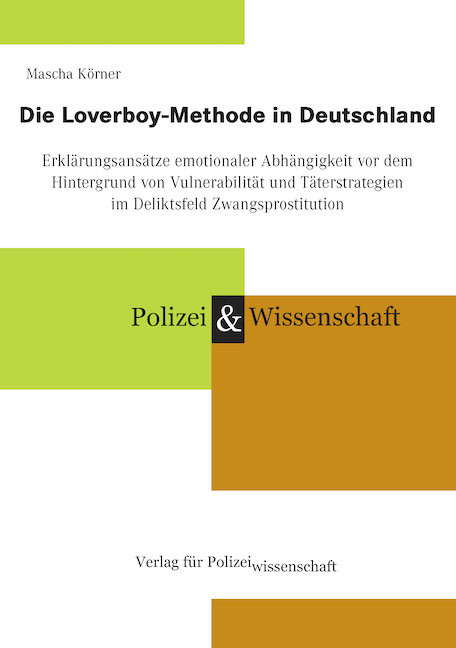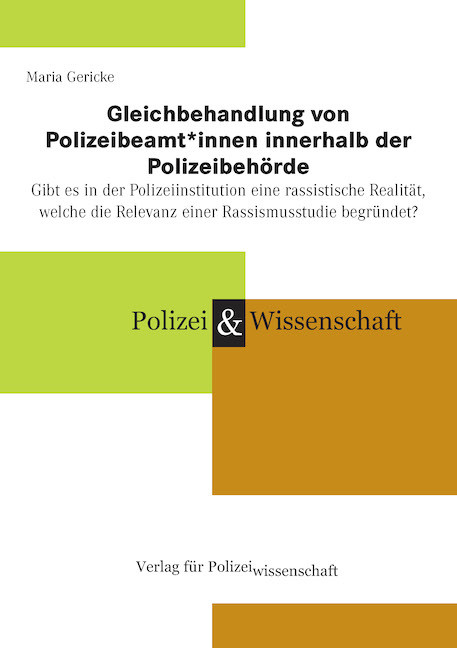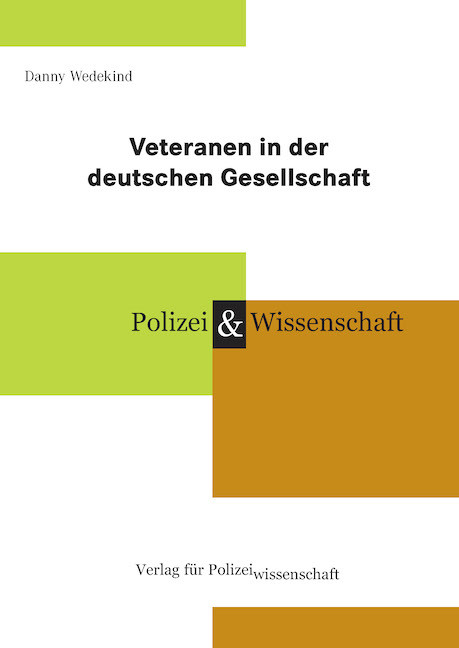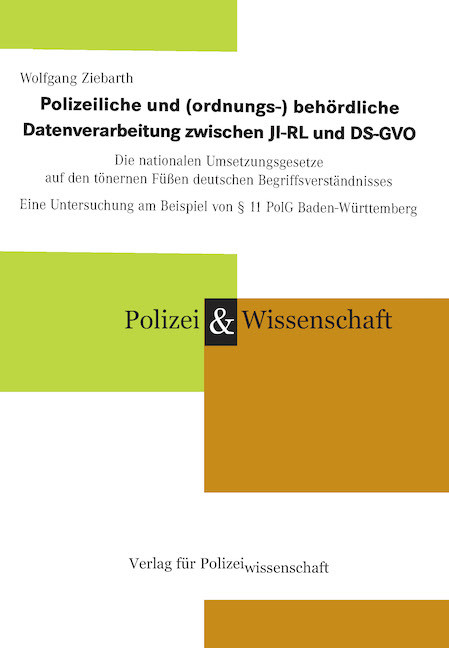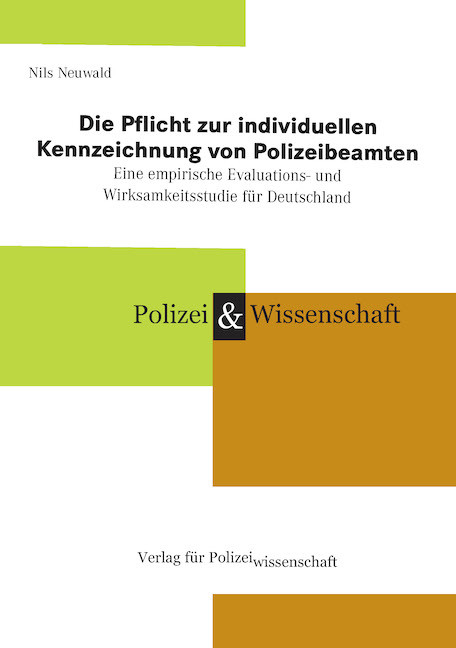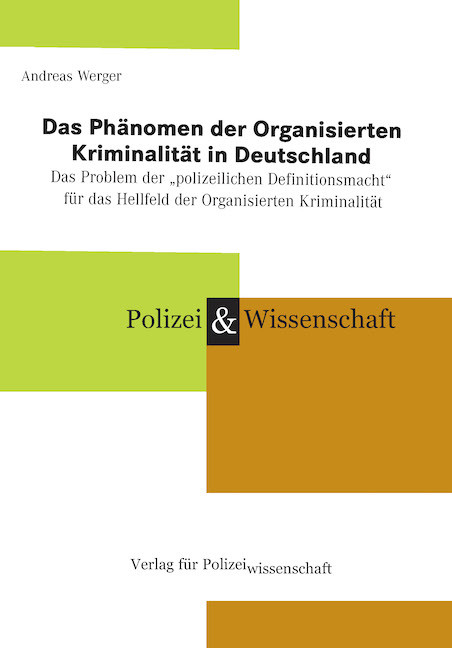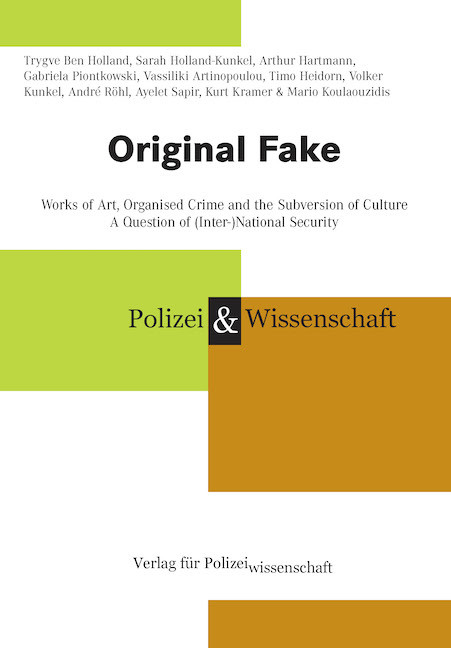Dorothee Dienstbühl
Ehrgewalt und Paralleljustiz in Deutschland Zwischen Generalverdacht und Verharmlosung
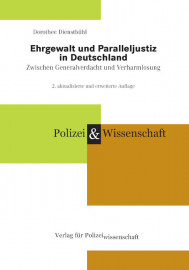
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Kulturelle Prägung
1.2 Tradiertes Familienbild
1.3 Vorislamische Zeit
1.4 Tatsächlicher Bezug zur islamischen Religion
1.5 Fazit: Ehre als teil-sakrale Tradition
2. Formen der Ehrgewalt
2.1 Ehrenmord
2.1.1 Der Fall Marget (†32) und Kathrin (†33)
2.1.2 Der Fall Lareeb K. (†19)
2.1.3 Der Fall Maria P. (†19)
2.1.4 Der Fall Maryam H. (†34)
2.1.5 Der Fall Büsra G. (†26)
2.1.6 Ehrenmorde und Beziehungstaten
2.2 Blutrache
2.3 Suizid
2.4 Die Rolle der Paralleljustiz für das Aufkommen von Ehrgewalt in Deutschland
3. Zwangsheirat, Polygamie und Kinderehen
3.1 Häusliche und alltägliche Gewalt
3.2 Ehrverbrechen zwischen Alltag und Einzelfall
4. Ehrverbrechen in der polizeilichen Ermittlung
4.1 Aufklärung von Ehrenmorden
4.2 Aufklärung von Gewalttaten der Blutrache
4.3 Zwangsverheiratungen und Zwangsehen
4.4 Ermittlungen und Opferschutz bei ehrmotivierter häuslicher Gewalt
4.5 Gefährdungseinschätzung und Erkennen von Hochrisikofällen
5. Berücksichtigung des Motivs der Ehre im Strafrecht
6. Umgang mit den Betroffenen von Ehrgewalt im Opferschutz und in der Beratung
7. Fazit: Politischer und gesellschaftlicher Auftrag
Anhang
1 Interview mit Sabatina James
2 Interview mit Ninve Ermagan
3 Interview Ahmad A. Omeirate
Stichwortverzeichnis
Quellenverzeichnis
Beratung, Hilfe und Adressen
Glossar
Mascha Körner
Die Loverboy-Methode in Deutschland Erklärungsansätze emotionaler Abhängigkeit vor dem Hintergrund von Vulnerabilität und Täterstrategien im Deliktsfeld Zwangsprostitution
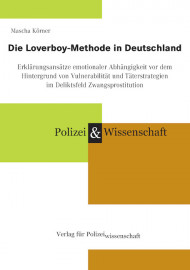
Dem gegenüber steht eine einseitige und oberflächliche Wissenslandschaft in Form von kleineren Randbefunden oder exemplarischen Einzelfalldarstellungen, die nicht immer auf empirischen Befunden fußen. Einseitige Darstellungen von Fallmerkmalen erwecken durch Reproduktion den Eindruck von Repräsentativität, wodurch wiederum die Gefahr besteht, dass keine facettenreichen und auch kontrastiven Erkenntnisse zu Fallverläufen, Täterstrategien oder Dynamiken der emotionalen Abhängigkeit in fachliche bzw. politische Diskurse und in strategische Konzepte bzw. Handlungsempfehlungen einfließen. Es bedarf einer dezidierten wissenschaftlichen Auseinandersetzung, die das Loverboy-Phänomen in seiner Breite betrachtet, Erkenntnisse systematisiert und theoretisch fundiert.
Das vorliegende Promotionsprojekt setzt an dieser Forschungslücke an. Basierend auf Fallrekonstruktionen wurden drei typische Fallverlaufsmuster identifiziert, die sich in der Gestaltung der Prostitutionszuführung sowie des Zwangsmitteleinsatzes differenzieren. Über die theoriebasierte Analyse des Zusammenspiels von Vulnerabilität und Täterstrategien werden Ent-stehung, Aufrechterhaltung und auch Beständigkeit emotionaler Abhängigkeit erklärt, wodurch unter anderem die oft angenommene Freiwilligkeit der Prostitutionstätigkeit – als eine der zentralen Herausforderung im Strafverfahren – negiert werden kann.
Inhalt
Inhalt:
1. Einleitung: gesellschaftliche Relevanz, Zielsetzung und Aufbau
2. Das Loverboy-Phänomen: Begriff, Problemfeld und bisherige Erkenntnisse
2.1 Begriffliche Klärung
2.2 Einführung in das Problemfeld
2.3 Der Forschungsstand zum Loverboy-Phänomen
3. Theoretischer Bezugsrahmen
3.1 Herleitung der Auswahl relevanter theoretischer Ansätze
3.2 Vulnerabilität aus lern- und entwicklungspsychologischer Perspektive
3.3 Sozialpsychologische Betrachtung der Beziehungsebene
4. Forschungsparadigma und Untersuchungsdesign
4.1 Forschungsparadigma der Untersuchung
4.2 Beschreibung der Vorstudie
4.3 Beschreibung der Hauptuntersuchung
5. Ergebnisse zu Vulnerabilität, Täterstrategien und emotionaler Abhängigkeit
5.1 Die Anbahnungsphase: Emotionale Abhängigkeit als Ausgangspunkt
5.2 Fallverlauf: Typisierung und Einzelfallbeschreibungen
5.3 Untypische Elemente im Fallverlauf
5.4 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse
6. Diskussion und Bewertung der Ergebnisse
6.1 Entstehung emotionaler Abhängigkeit durch Instrumentalisierung von Vulnerabilität
6.2 Täterstrategien und abhängigkeitsfördernde Dynamiken im Loverboy-Fallverlauf
6.3 Bewertung und Ausblick
7. Verzeichnisse
Maria Gericke
Gleichbehandlung von Polizeibeamt*innen innerhalb der Polizeibehörde Gibt es in der Polizeiinstitution eine rassistische Realität, welche die Relevanz einer Rassismusstudie begründet?
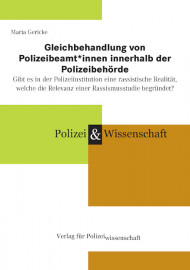
Die Arbeit widmet sich vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um die Polizeistudie sowie den Verschließungstendenzen der Polizeiinstitution gegenüber empirischer Forschung der Frage, ob in der Polizeiinstitution rassistische Realitäten vorliegen, welche die Relevanz einer Rassismusstudie begründen. Der Fokus liegt hierbei auf den Polizist*innen mit Einwanderungsgeschichte bzw. Vielfältigkeitsmerkmalen und deren Akzeptanz innerhalb ihres herkunftsdeutschen Kolleg*innenkreises. Die Erforschung erfolgt entlang des seitens der Institution artikulierten Gleichbehandlungsgrundsatzes und geht der Überlegung nach, ob es sich bei dem arbeitsrechtlichen Grundsatz um ein der Diversität zuträgliches Anliegen handelt.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Forschungsfrage / Zielsetzung der Arbeit
1.3 Methodik
1.4 Aufbau der Arbeit; Literatur- und Kapitelübersicht
2 Grundlagen und theoretischer Hintergrund
2.1 Über Rassismen als Ideologie
2.2 Rassismen und ihre Erscheinungsformen
3 Migration, Integration und die zweite Generation
3.1 Interkulturalität und Transkulturalität
3.2 Integration durch Teilhabeberechtigung
3.3 Die ‚nationale Identität‘: Konservatismus und Traditionalismus
3.4 Interkulturelle Kompetenz als soziales Vermögen im Polizeiberuf
4 Forschungszugang und Polizei
4.1 Ein Blick in die Geschichte ab 1990
4.2 Die Relevanz von Forschung zu innerpolizeilichen Einstellungsmustern
4.3 Studienlage und Forschungsstand
4.4 Institutionalisierte Diskriminierung
4.5 Abgelehnte Rassismusstudien / Polizeistudie
4.6 Die Stimme der Polizeigewerkschaften
5 Die Polizeiinstitution: Strukturen und Kulturen
5.1 Die Polizeiorganisation: Eine Institution
5.2 Kulturen in der Polizei
5.3 Cop Culture und die Anfälligkeit für diskriminierende Strukturen
5.4 Polizeiinterne Bekenntnisse und Loyalitätsbindung
5.5 Soziale Dominanzorientierung
6 Gleichbehandlung oder Gerechtigkeit
6.1 Das dringliche dienstliche Interesse an Polizist*innen mit Migrationsgeschichte
6.2 Einstellung von Personen mit Migrationsgeschichte in den Polizeidienst
6.3 Motive für Personen mit Migrationsgeschichte den Polizeiberuf zu ergreifen
6.4 Gleichbehandlung vs. Diversität
6.5 Gleichberechtigung anstelle von Gleichbehandlung
7 Kreieren des „Anderen“: Sozial-psychologische Theorieansätze
7.1 Aktivierung von Frames über Sprache
7.2 Soziale Identitätstheorie
7.3 Othering
7.4 „Triple Jeopardy“
7.5 Umgang mit „fremd“ gelesenen Menschen als polizeiliches Gegenüber und Umgang mit „ausländisch“ gelesenen Menschen als Kolleg*innen
7.6 Die innerpolizeiliche, einheimische Akzeptanz von „Anders-Sein“
7.7 Wir- / Sie-Gruppen und die Reduzierung von Animositäten
7.8 Die Kontakthypothese nach Allport
8 Kritikkultur und Ausblick
8.1 Abwehrverhalten und Bagatellisierung
8.2 Verzahnung von Reformansätzen
9 Schlussdiskussion: (Feld)Forschung als zielführendes, umsetzbares und legitimes Mittel zur Gestaltung einer interkulturell kompetenten und vorurteilsfreieren Polizei
Literaturverzeichnis
Anhang
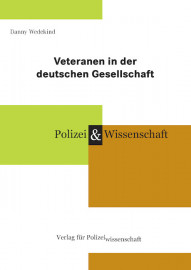
Der Forschungsgegenstand wird als biographische Bearbeitung einer Einsatzrealität konzeptualisiert, die einen Bruch zwischen den Normalitätsvorstellung der Heimgesellschaft und den Erfahrungen einer Soldatenwirklichkeit postuliert. Diese Annahmen erfolgen vor dem Hintergrund, dass sich der Bruch für die Einsatzrückkehrer der Bundeswehr schärfer darstellt, da es sich ebenso um einen Bruch mit dem Selbstverständnis einer zuvorderst auf Landesverteidigung ausgerichteten Armee handelt.
Aus diesem Grund werden zunächst die Verwendungsweise des Veteranenbegriffes in der politischen Kultur und die Entstehungsgeschichte und die Entwicklung eines Selbstverständnisses der Bundeswehr nach ihrer Gründung beleuchtet. Im Folgenden wird der Afghanistaneinsatz als ein Wendepunkt deutscher Nachkriegsgeschichte in den Fokus gerückt. Das Zentrum der Arbeit bilden drei ausführliche Rekonstruktionen sich gegenseitig ergänzender Fälle mit der Absicht, verschiedene Typen der Verarbeitung und der Renormalisierung zu kennzeichnen.
Inhalt
Inhalt:
Danksagung
Inhaltsverzeichnis
Stand der Dinge
2. Einleitung – Veteranen in der deutschen Gesellschaft
3. Entstehungsgeschichte und Selbstverständnis der Bundeswehr
3.1. Die Gründungsgeschichte der Bundeswehr
3.2. Entwicklung eines Selbstverständnisses im Nachkriegsdeutschland
3.3. Die Rolle der Bundeswehr während und nach dem Kalten Krieg
4. Erste Einsätze – erste Veteranen – Wendepunkt Afghanistan
4.1. Die ersten Einsätze der Bundeswehr
4.2. Wendepunkt Afghanistan
4.3. Post-ISAF und neue Herausforderungen
5. Biographischer Bruch Bundeswehr
6. Datenaufnahme
7. Deutsche Veteranen – eine soziologische Reformulierung
8. Zur weiteren Kontextualisierung
9. Drei Porträts
9.1. Der biographische Ausbruch des Hans Jäger
9.2. Kein Weg zurück oder „wer reist schon nach Afghanistan“?
9.3. „Drei Minuten, die sie wahrscheinlich nie wieder vergessen werden“
10. Die Porträts im Deutungszusammenhang
11. Ausblick
Literaturverzeichnis
Wolfgang Ziebarth
Polizeiliche und (ordnungs-) behördliche Datenverarbeitung zwischen JI-RL und DS-GVO Die nationalen Umsetzungsgesetze auf den tönernen Füßen deutschen Begriffsverständnisses Eine Untersuchung am Beispiel von § 11 PolG Baden-Württemberg

Schwierigkeiten bestehen unter anderem in der Abgrenzung der Anwendungsbereiche der beiden Rechtsakte. Polizeiliche Datenverarbeitung wird weitgehend von der JI-RL determiniert, während sich nichtpolizeiliche Datenverarbeitung weitgehend nach der DS-GVO zu richten hat.
Wo aber verläuft die Grenze genau? Für welche Verarbeitungen gilt die DS-GVO und für welche gelten die Gesetze, die die JI-RL umsetzen? Dies wird in beiden Rechtsakten spiegelbildlich geregelt. Dabei werden Begriffe verwendet, die uns in Deutschland vertraut vorkommen. Zum Beispiel „Straftaten“ oder „öffentliche Sicherheit“. Die Umsetzungsgesetze in Deutschland basieren auf der Annahme, dass Begriffe dasselbe bedeuten wie im deutschen Recht. Aber nichts spricht dafür, dass das so sein könnte. Schon in Österreich versteht man unter „öffentlicher Sicherheit“ etwas Anderes als in Deutschland. Wenn aber die Begriffe, die der Abgrenzung von DS-GVO und JI-RL voneinander dienen, unklaren Inhalt haben, dann haben wir mit großer Wahrscheinlichkeit die europäische Datenschutzreform nicht korrekt umgesetzt.
Meint der unionsrechtliche Begriff „Straftaten“ auch deutsche Ordnungswidrigkeiten? Oder disziplinarrechtliche Dienstvergehen? Ist die Jugendgerichtshilfe nicht eine zuständige Behörde, die Daten zu Zwecken der Strafverfolgung und vollstreckung verarbeitet? Wehren Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz nicht auch Gefahren ab, die aus Straftaten resultieren?
Über diese im gesamten EWR relevanten Fragen hinaus werden die Umsetzungsschwierigkeiten am Beispiel des § 11 Polizeigesetz Baden-Württemberg erörtert – einer besonders misslungenen Vorschrift, die ihren Zweck verfehlt, die Weichen zwischen der Anwendbarkeit der DS-GVO und der zur Umsetzung der JI-RL geschaffenen Gesetze zu stellen.
Inhalt
Inhalt:
Literaturverzeichnis
A. Datenverarbeitung durch die Polizei
I. Begriff der Polizei
II. Datenverarbeitungen
B. Übergesetzliches Umfeld der polizeilichen Datenverarbeitung
I. Grundrechte
II. Gesetzgebungskompetenz
III. Europäisches Sekundärrecht
IV. Die zu beachtende Gemengelage bindender Vorschriften
C. Die Lösung des Gesetzgebers in Baden-Württemberg: § 11 PolG
I. § 11 Abs. 1 PolG
II. § 11 Abs. 2 PolG
D. Folgen für den polizeilichen Alltag
I. Verfolgung und Vollstreckung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
II. Gefahrenabwehr
III. Nicht-polizeiliche Tätigkeit der Polizei
E. Ein Beispielsfall im Anwendungsbereich der JI-RL (§ 11 Abs. 1 PolG)
I. Sachverhalt
II. Lösung
F. Ein Beispielsfall im Anwendungsbereich der DS-GVO (§ 11 Abs. 2 PolG)
I. Sachverhalt
II. Lösung
G. Zwischenergebnis
H. Präzisierung des bisherigen Ergebnisses
I. Verarbeitungen durch Unionsbehörden
II. Nichtautomatisierte Verarbeitung ohne Dateisystem
I. Eine Welt ohne § 11 PolG
J. Folgerungen
I. Folgerungen für die Gesetzgebung
II. Folgerungen für die Ausbildung
III. Folgerungen für die Wissenschaft
Abkürzungsverzeichnis
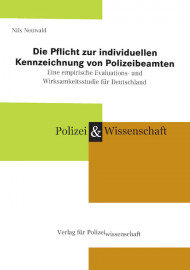
Zu diesem Zweck wurden umfangreich Literatur, Rechtsprechung und diverse Quellen ausgewertet sowie zahlreiche Anfragen bei Ministerien, Polizeigewerkschaften, NGO´s und politische Parteien durchgeführt.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
1 Thematische Einführung und Relevanz der Fragestellung
1.1 Aktualit.t und Bedeutung des Themas
1.2 Ziel und replizierender Ansatz der Arbeit
2 Forschungsdesign
2.1 Theoretischer Kontext der Arbeit
2.2 Begriffsbestimmung und Eingrenzung des Themas
2.3 Stand der Forschung
2.4 Untersuchungsfragestellung
2.5 Methodik, Design und Vorgehen bei der Datenerhebung
3 Kennzeichnungspflicht in Deutschland
3.1 Bund
3.2 Baden-Württemberg
3.3 Bayern
3.4 Berlin
3.5 Brandenburg
3.6 Bremen
3.7 Hamburg
3.8 Hessen
3.9 Mecklenburg-Vorpommern
3.10 Niedersachsen
3.11 Nordrhein-Westfalen
3.12 Rheinland-Pfalz
3.13 Saarland
3.14 Sachsen
3.15 Sachsen-Anhalt
3.16 Schleswig-Holstein
3.17 Thüringen
4 Positionen der Befürworter und Gegner der Kennzeichnungspflicht
4.1 Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen
4.2 Polizeigewerkschaften
4.3 Politische Parteien
5 Analyse und Bewertung der diskussionsprägenden Argumente
5.1 Beamte können aufgrund ihrer Uniformierung nicht ermittelt werden
5.2 Ausreichen der Ausweispflicht
5.3 Ausreichen der normalen taktischen Kennzeichnung
5.4 Zunahme unberechtigter Anzeigen
5.5 Gefährdung der Beamten und ihrer Angehörigen
5.6 Unzulässiger Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
5.7 Rechtspflicht zur Einführung einer individuellen Kennzeichnung
5.8 Negative Auswirkung auf Motivation und Akzeptanz durch die Beamten
5.9 Polizeibeamte werden unter Generalverdacht gestellt
5.10 Verhaltenspsychologische Aspekte (Deindividuation)
5.11 Verbesserung des Verhältnisses zur Bevölkerung
5.12 Selbstreinigungskräfte der Polizei und „Die Mauer des Schweigens“
5.13 Geeignetheit und Wirksamkeit der Kennzeichnungspflicht
6 Darstellung der wesentlichen Forschungsergebnisse
6.1 Wie hat sich die Kennzeichnungspflicht in den Bundesländern etabliert?
6.2 Gibt es Veränderungen/Anpassungen in den Positionen der Akteure?
6.3 Welche Argumente werden vorgebracht? Gibt es Anpassungen?
6.4 Wie überzeugend sind die Hauptargumente?
6.5 Wie ist die Rechtslage?
6.6 Welche Probleme sind bei der Einführung und Nutzung aufgetreten?
6.7 Welche Anpassungen wurden vorgenommen, sind beabsichtigt?
6.8 Welche Anpassungen sollten vorgenommen werden?
6.9 Wie sollte eine Kennzeichnungspflicht allgemein umgesetzt werden?
6.10 Bedarf es einer verpflichtenden Kennzeichnung?
7 Zusammenfassung und Fazit
Anhang
Literatur- und Quellenverzeichnis
Andreas Werger
Das Phänomen der Organisierten Kriminalität in Deutschland - Das Problem der „polizeilichen Definitionsmacht“ für das Hellfeld der Organisierten Kriminalität
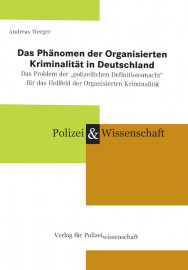
Inhalt
Inhalt:
1. Einleitung
1.1 Definitorische Eingrenzung des Phänomens OK und dessen „Tücken"
1.2 Organisierte Kriminalität als „Organisationsdelikt"
1.3 Das Hellfeld der OK als rein sicherheitsbehördliches Lagebild
1.3.1 Die „Definitionsmacht der Polizei"
1.3.2 Aussagegehalt vorhandener empirischer Forschung
1.4 Methode
1.5 Untersuchungsannahme
1.6 Forschungsleitende Fragen
1.7 Aufbau und Gliederung
2. Historische Entwicklung der Organisierten Kriminalität in Deutschland
2.1 Phänomene der Organisierten Kriminalität in Deutschland 19
2.2 Kriminalpolitische Forderungen und Reaktionen 25
3. Definition des Begriffes der Organisierten Kriminalität in Deutschland
3.1 Entwicklung zur gültigen Arbeitsdefinition
3.1.1 Definition nach der Fachkommission der AG Kripo (1974)
3.1.2 Definition nach dem Ad hoc-Ausschuss des Arbeitskreises II der Innenministerkonferenz
3.1.3 Arbeitsdefinition Organisierte Kriminalität seit 1990
3.1.4 Kritik an der Arbeitsdefinition
3.2 Definition im materiellen Recht
3.3 Allgemeines Verständnis von Organisierter Kriminalität
3.4 Reflexion auf die forschungsleitenden Fragen 1 und 2
4. Charakteristika von OK- Verfahren
4.1 Hellfeld der Organisierten Kriminalität
4.2 Deliktsfelder der Organisierten Kriminalität
4.2.1 Kontrolldelikte
4.2.2 Einleitungsgrundlage für OK-Verfahren
4.2.3 Polizeiliche Strukturen zur OK-Bekämpfung
4.3. Diskrepanz Hellfeld und Dunkelfeld
4.4 Reflexion auf die forschungsleitende Frage 3
5. Analyse bisheriger empirischer Forschung zu Organisierter Kriminalität
6. Die Definitionsmacht der Polizei und Reflexion auf die Untersuchungsannahme sowie die forschungsleitende Frage 4
7. Möglichkeiten zur objektiven Generierung und Bewertung von OK-Ermittlungen
7.1 Modifizierung der Kriminalstatistik zu einer Bedrohungsanalyse
7.1.1 Ergänzungen zum Bundeslagebild OK
7.1.2 Zukunftsorientierung im Sinne eines intelligence-led policing
7.1.3 Einheitliche Betrachtung von OK und dessen Vorfeldkriminalität
7.1.4 Notwendiger Ausbau empirischer Forschung zu OK
7.2 Optimierung der kriminalstrategischen Schwerpunktsetzung
7.2.1 KOK-Schwerpunktbildungsprozess
7.2.2 Harmonisierung mit dem EU-Policy Cycle
7.2.3 Elemente des Projektmanagements bei der Schwerpunktbildung
7.2.4 Harmonisierung von Ermittlungsverfahren mit der Schwerpunktbildung
7.3 Organisierte Kriminalität im Sinne einer Netzstrukturkriminalität
7.4 Qualitative Bewertungen im Phänomenbereich OK
7.4.1 Qualitative Priorisierung von Ermittlungsverfahren
7.4.2 Organised Crime Group Mapping
7.4.3 Risiken des Organised Crime Group Mapping
7.4.4 Risikoorientierte Modelle zur qualitativen OK-Bewertung
7.4.5 Messung von Erfolg
7.5 Weitere strukturelle Modifikationen
7.5.1 Ausrichtung der Dienststellenstruktur bei OK-Ermittlungen
7.5.2 Aus- und Fortbildung im Bereich der OK
7.5.3 Bewertung der OK-Relevanz durch die Justiz
8. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anlage (OK-Indikatoren)
Trygve Ben Holland, Sarah Holland-Kunkel, Arthur Hartmann, Gabriela Piontkowski, Vassiliki Artinopoulou, Timo Heidorn, Volker Kunkel, André Röhl, Ayelet Sapir, Kurt Kramer & Mario Koulaouzidis
Original Fake Works of Art, Organised Crime and the Subversion of Culture A Question of (Inter-)National Security
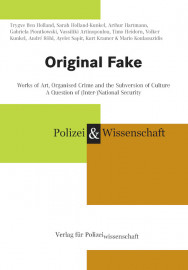
Mit vorliegendem Buch wird im Rahmen eines von der EU aus dem ISF geförderten Projektes ein Polycrime-Konglomerat adressiert, das sich auf illegale archäologische Ausgrabungen, den Handel mit diesen Kulturgütern sowie insbesondere auf Fälschungen von Artefakten – Original Fakes – bezieht. Dass illegale Ausgrabungen und der Handel mit diesen Gegenständen nicht im Einklang mit geltendem Recht stehen, ist unzweifelhaft und zugleich, ebenso wie die Anfertigung vermeintlicher originaler archäologischer Kulturgüter, Gegenstand des Gewinnstrebens – mittels Geldwäsche – Krimineller Netzwerke, kann jedoch auch in Teilen politische Hintergründe haben. Durch diese thematische Mehrschichtigkeit sowie deren negative Auswirkungen auf die geschichtlich-gesellschaftlichen Dimensionen der Ausbeutung und Verfälschung von Kulturgütern wird ein (nicht nur strafvollzugsbezogenes) Tätigkeitsfeld definiert, auf das die EU aus einer Vielzahl von darzulegenden Gründen verstärktes Augenmerk zu legen hat.
Inhalt
Inhalt:
1 On the Legal and Commercial Concept of Art
1.1 The Issue at Question
1.2 Of Art and Cultural Property
1.2.1 A Cursory Historic Overview
1.2.2 The European Dimension
1.2.3 On Domestic Definitions
1.3 Categorising the Scope
1.3.1 Categories
1.3.2 What is Everything About, Basically?
1.3.3 A Critical View
1.4 The Commercial Dimension
1.4.1 A biased Public Hand's Interest
1.4.2 Private Sales
2 Policies and Policing in the EU
2.1 About
2.2 AFSJ Dimension
2.2.1 Cross-border Cooperation
2.2.2 Trainings
2.3 Arts and Human Rights
2.3.1 Scope of Protection
2.3.2 Cultural Rights and Cultural Heritage Protection
2.4 Member States
2.4.1 Specialised Law Enforcement Units
2.4.2 Customs Cooperation
2.4.3 Current Developments
2.5 Enlargement: The Western Balkans
2.5.1 Legal Framework
2.5.2 Albania
3 Cases, Scenarios and Questions
3.1 Background
3.1.1 Tasks and Objectives
3.1.2 First Indications and Initial Links
3.2 Getting to the Core
3.2.1 Pseudo-Judaica and the like .all over the place (any)
3.2.2 The fakest Fake of Fakes - But which one? If any, at all?
3.2.3 To Whom these Bells Toll
3.2.4 My Precious!
3.2.5 Illegally excavated Originals, aren't they?
Conclusive Summary
About the Authors
Sources