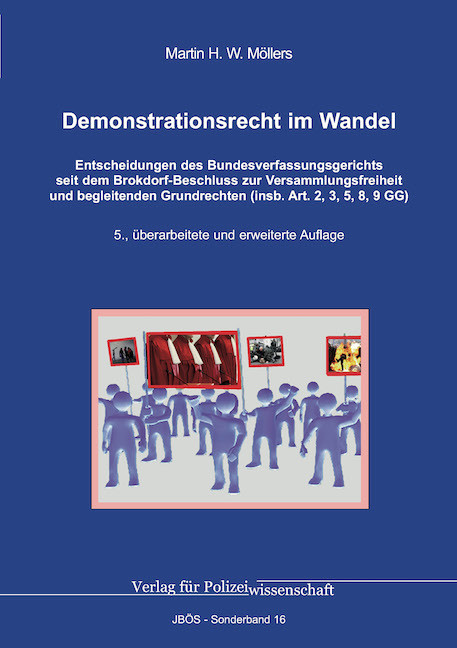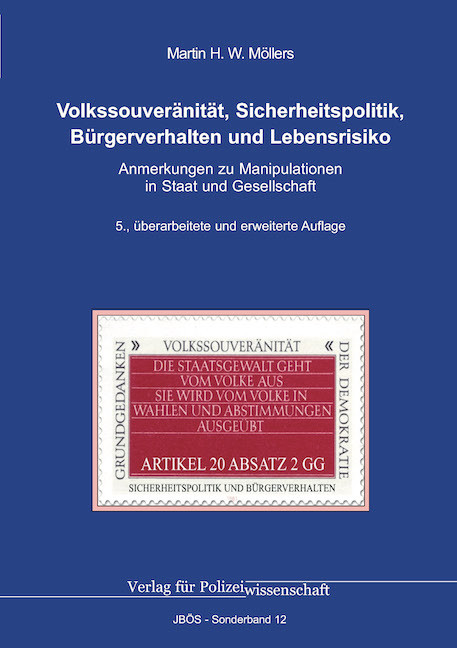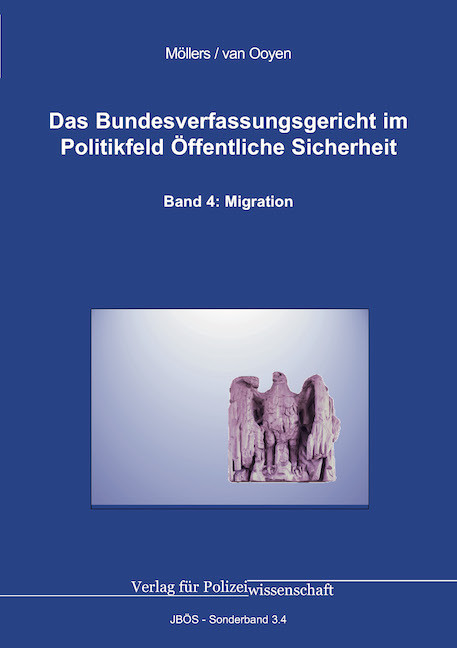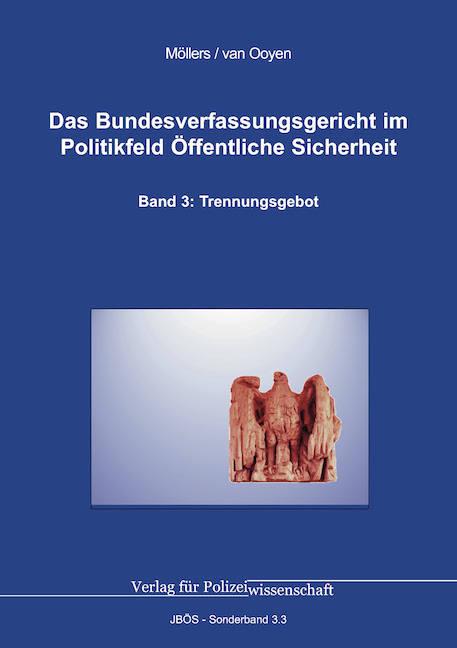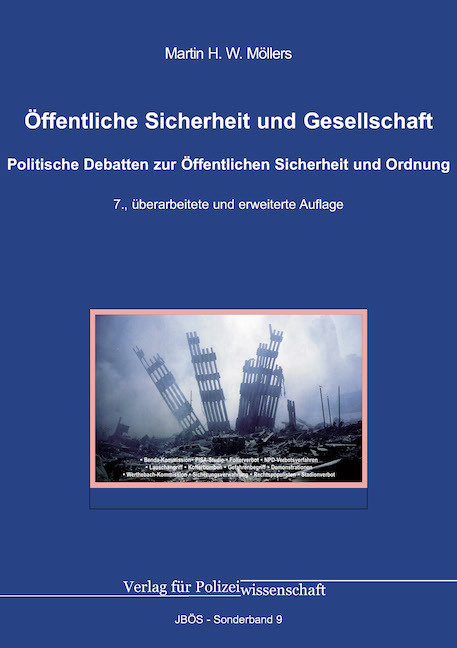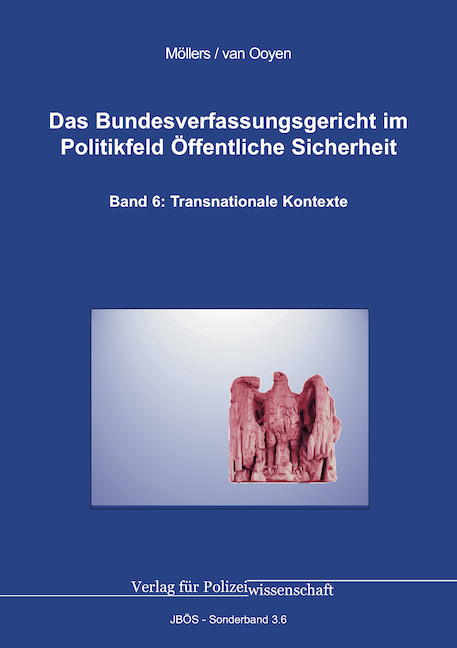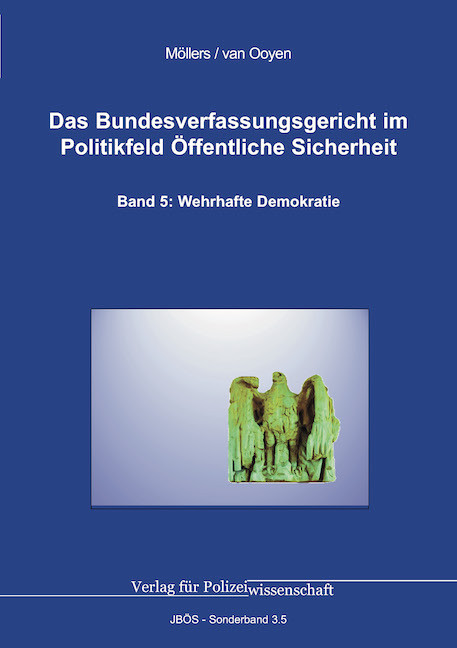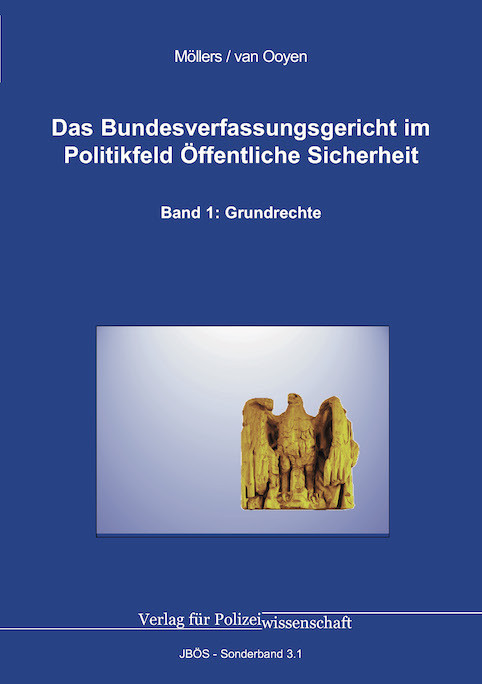Martin H. W. Möllers
Demonstrationsrecht im Wandel Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts seit dem Brokdorf-Beschluss zur Versammlungsfreiheit und begleitenden Grundrechten (insb. Art. 2, 3, 5, 8, 9 GG) 5., überarbeitete und erweiterte Auflage
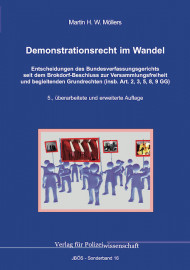
Versammlungen unter freiem Himmel haben sich aufgrund des Erstarkens rechtsextremistischer, fremdenfeindlicher Tendenzen in der Bevölkerung in letzter Zeit erheblich quantitativ vermehrt. Neben „Reichsbürgern“, die sich nicht nur durch Aufmärsche hervortaten, sondern bereits zweimal einen Staatsstreich planten, „Pegida“ und ihre Ableger und insbesondere die AfD, die inzwischen als gesichert rechtsextremistisch vom Bundesamt für Verfassungsschutz eingestuft wurde, sowie das Netzwerk jugendlicher, gewaltbereiter Rechtsextremisten, die sich in friedliche Versammlungen anderer einschleichen, sind dafür beredtes Beispiel. Die „Gegenbewegungen“ gestalten zwar bürgerliche Kreise. Ihre Wahrnehmung geht aber in der Öffentlichkeit durch Gewaltexzesse dieser rechts- und der linksextremistischen Szene (Autonome) unter. Die Polizei rüstet auf – zum Unmut von dadurch in ihren Grundrechten betroffenen Menschen.
In den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Versammlungsfreiheit spielen „Rechtsprechungstradition“, „Staatsräson“ und auch der „Zeitgeist“ eine wesentliche Rolle. Denn auch das Recht spiegelt lediglich eine aktuelle politische Situation wider, welche die Gesetzgeber durch ihr Gesetz beherrschen wollen. Und Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts sind ebenfalls nicht frei von Beeinflussung durch ihre Umwelt. Sie scheuen sich nicht, eigene rechtspolitische Auffassungen in ihren Entscheidungen unterzubringen, mit denen sie auch Rechtstraditionen durchbrechen.
Anhand vieler Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Versammlungsfreiheit sowie den mit der Versammlungsfreiheit im Zusammenhang stehenden Grundrechten lässt sich deutlich erkennen, dass beide Senate zwischen dem Schutz der Grundrechte und der Funktionsfähigkeit des Staates oszillieren.
Das Buch dokumentiert auszugsweise ausgewählte Entscheidungen zur Versammlungsfreiheit und weist den Gerichtsentscheidungen in der Kommentierung „Rechtsprechungstradition“, „Staatsräson“ und „Zeitgeist“ nach.
Inhalt
Inhalt:
Einführung
Das Demonstrationsrecht und die Grundrechte-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
1 Das Staatsverständnis des Bundesverfassungsgerichts zu den Grundrechten als Leitlinien für die Exekutive
2 Verdeckte Vorfeldermittlungen im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz als Gefahr für die Beschränkung der Versammlungsfreiheit
Brokdorf-Beschluss
,Rechtsprechungstradition‘, ,Zeitgeist‘ und ,Staatsräson‘ in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Versammlungsfreiheit seit dem Brokdorf-Beschluss
1 Dokumentation BVerfGE 69, 315-372 –Brokdorf-Beschluss [Auszug]
2 Die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit in der vorkonstitutionellen deutschen Tradition
3 Der Brokdorf-Beschluss als Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts
4 Die Folgewirkungen des liberalen Brokdorf-Beschlusses auf spätere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Versammlungsfreiheit
Wunsiedel- und Bielefeld-Beschlüsse
Das Sonderrecht bei Meinungsäußerungen von Rechtsextremisten im Wunsiedel-Beschluss in Gegenüberstellung mit dem Bielefeld-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
1 Dokumentation BVerfG, 1 BvR 2150/08 vom 4.11.2009, Rn. 1-110 – Wunsiedel-Beschluss [Auszug]
2 Dokumentation BVerfG, 1 BvR 2636/04 vom 12.5.2010, Rn. 1-32 – Bielefeld-Kammerbeschluss [Auszug]
3 Einführende kurze Anmerkungen zu beiden Entscheidungen
4 Die Entscheidungsbedeutung des Wunsiedel-Beschlusses
5 Der Bielefeld-Beschluss im Lichte von ,Wunsiedel‘
6 Quintessenz und Ausblick
,Rechtsverletzende‘ oder ,rein geistige Wirkungen‘ von rechtspopulistischen Demonstrationen – Zu den auf deutscher Rechtstradition basierenden rechtlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für Versammlungen von AfD und anderen rechtsextremistischen Gruppen
1 Einleitung zur Historie des Versammlungsrechts und zur Vorgehensweise
2 Die Bedeutung der Grundrechte als ,oberste Prinzipien‘
3 Die Versammlungsfreiheit in der vorkonstitutionellen deutschen Tradition
4 Die Versammlungsfreiheit in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
5 Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu ,rechtsverletzenden‘ und ,rein geistigen Wirkungen‘
6 Zusammenfassung und Ausblick
Fraport-Entscheidung
Die Fraport-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Stärkung des Demonstrationsrechts auf Flughäfen, Bahnhöfen und in Einkaufszentren
1 Dokumentation BVerfG, 1 BvR 699/06 vom 22.2.2011, Rn. 1-128 – Fraport-Urteil [Auszug]
2 Die Ausgangslage der gerichtlichen Entscheidung
3 Die Leitsätze
4 Keine Begrenzung des Schutzbereichs der Meinungsfreiheit auf öffentliche, der Kommunikation dienende Foren
5 Prognosen aus dem Urteil
Polizeikessel-Kammerbeschluss
Abkehr vom liberalen Brokdorf-Beschluss? Die Kammer-Entscheidung des BVerfG zur Rechtmäßigkeit eines Polizeikessels vom 2.11.2016
1 Dokumentation BVerfG, 1 BvR 699/06 vom 22.2.2011, Rn. 1-128 – Polizeikessel-Beschluss [Auszug]
2 Einleitung zur Problematik
3 Grundlagen des Brokdorf-Beschlusses
4 Die Einkesselung als Grundrechtsproblem
5 Beurteilung des dem BVerfG vorliegenden Sachverhalts durch die Kammer
6 Bewertung des Kammerbeschlusses zum Polizeikessel und Ausblick
Identitätsfeststellungen auf Versammlungen
Hürde für die Polizei im Demonstrationsrecht: Identitätsfeststellung im Rahmen einer Versammlung erfordert konkrete Gefahr für ein polizeiliches Schutzgut
1 Einleitung zur Problematik der Identitätsfeststellung
2 Hintergrund der Entscheidung und kritische Anmerkungen gegen die Begründung der Instanzengerichte
3 Erläuternde Begründung der Entscheidung der Kammer
Stadionverbot-Urteil
Die Problematik der Drittwirkung von Grundrechten: Zur Ausstrahlungswirkung des allgemeinen Gleichheitssatzes in das Zivilrecht im sog. ,Stadionverbot-Urteil‘ des BVerfG
1 Einführung zur Problematik der Drittwirkung von Grundrechten
2 Zur Ausstrahlungswirkung des allgemeinen Gleichheitssatzes in das Zivilrecht
3 Dokumentation: Stadionverbotsbeschluss des BVerfG vom 11. April 2018 - 1 BvR 3080/09 - Rn. 1-58 [Auszüge]
Entscheidungen in der Corona-Krise
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in der Corona-Krise in Gegenüberstellung zu Urteilen der Verwaltungsgerichte
1 Einführung zur Problematik der staatlichen Maßnahmen in der Corona-Pandemie
2 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu den ersten Verfassungsbeschwerden im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie
3 Entscheidungen von Verwaltungsgerichten zu einzelnen Maßnahmen
4 Kammerbeschlüsse des BVerfG zu einzelnen Maßnahmen
5 Uneinheitlichkeit bei den Gerichtsentscheidungen und den Verordnungen der Landesregierungen bezüglich des Verbots, Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche mit mehr als 800 m2 zu öffnen
6 Verfassungsgerichtliche Entscheidungen zu den ersten ,Lockerungen‘ von Freiheitsbeschränkungen nach Beschluss von Bund und Ländern
Martin H. W. Möllers
Volkssouveränität, Sicherheitspolitik, Bürgerverhalten und Lebensrisiko Anmerkungen zu Manipulationen in Staat und Gesellschaft 5., überarbeitete und erweiterte Auflage
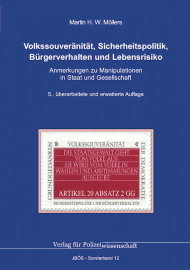
Inhalt
Inhalt:
Einführung zu den Theorien über Manipulationen von Staat und Gesellschaft
Volkssouveränität
Prinzipien der Volkssouveränität und ihre Entwicklung im 21. Jahrhundert unter Berücksichtigung sicherheitspolitischer Aspekte
Staat oder Verfassung – politische Einheit oder pluralistische Gesellschaft? Der Begriff des Staatsvolks aus verfassungstheoretischer Sicht
Sicherheitspolitik
Organisation und Vernetzung der Sicherheitsarchitektur in Deutschland
Die Sicherungsverwahrung als Spielball von Politik und Rechtsprechung
Freiheitsbeschränkungen infolge der Coronavirus SARS CoV-2 Pandemie – Willkür oder Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit?
Bürgerverhalten
Das traditionelle Bürgerverhalten, die politische Kultur in Deutschland
Lebensrisiko
Die Unantastbarkeit der Menschenwürde – keine Abwägung Leben gegen Leben
Die gesteuerte Wahrnehmung von Risiken in der Bevölkerung als Motor der Sicherheitsarchitektur
Martin H. W. Möllers / Robert Chr. van Ooyen
Das Bundesverfassungsgericht im Politikfeld Öffentliche Sicherheit Band 4: Migration
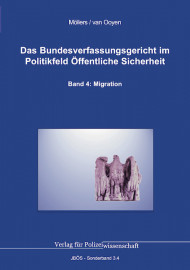
Kaum eine Materie der Verfassungsrechtsprechung hat in den letzten Jahren eine solche Spruchdichte hervorgerufen wie das Politikfeld der Öffentlichen Sicherheit. Ob Lauschangriff und Rasterfahndung, Versammlungsfreiheit und Online-Durchsuchung, ob Vorratsdatenspeicherung und Sicherungsverwahrung, Europäischer Haftbefehl und Luftsicherheitsgesetz, Bundeswehreinsatz out of area und im Innern – aber auch Grundrechtsgeltung im Ausland und „Kopftuch“ im Öffentlichen Dienst: Durch den populären Ruf nach mehr „Sicherheit“ hat sich das Bundesverfassungsgericht wie selten zuvor herausgefordert gesehen, Parlament und Regierung Grenzen zu ziehen. Dabei ist es selbst an die Grenzen der Verfassungsrechtsschöpfung gedrungen, hat zugleich erhebliche Zugeständnisse gegenüber den Sicherheitsbehörden gemacht und angesichts des Notstands in der Pandemiebekämpfung sogar die flächendeckende „Grundrechts-Suspendierung“ weitestgehend „durchgewunken“.
Diese rechtspolitische Entwicklung infolge des Paradigmenwechsels in der Öffentlichen Sicherheit ist noch nicht abgeschlossen, hat sich aber nach einer Reihe von Grundsatzentscheidungen vorerst konsolidiert, sodass eine Bestandsaufnahme möglich ist. Dabei werden Kontinuitäten und Brüche in der Rechtsprechung deutlich, die sich durch die Auseinandersetzung mit dem EuGH und EGMR in den europäischen Bereich verlängert. In den sechs Teilgebieten wird analysiert:
• die allgemeine Rechtsprechung zu den Grundrechten (Band 1),
• die Rechtsprechung zur Polizei (Band 2),
• die Rechtsprechung zur Trennung von Polizei, Nachrichtendiensten und Militär (Band 3),
• die Rechtsprechung zur Migration (Band 4),
• die Rechtsprechung zur wehrhaften Demokratie (Band 5) und
• die Rechtsprechung zu transnationalen Kontexten (Band 6).
Inhalt
Inhalt:
Martin H. W. Möllers
Bemerkungen zur amtlichen Definition des Begriffs „Migrationshintergrund“ und seine Verwendung in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
Robert Chr. van Ooyen
,Kopftuch‘ und Religionsfreiheit vor Gericht: Die Verfassungsrechtsprechung im rechtspolitischen Kontext
Robert Chr. van Ooyen
„Migrationskrise als föderales Verfassungsproblem“? Wo Gutachter Di Fabio recht haben könnte – und wo nicht
Robert Chr. van Ooyen
Kein Ausländerwahlrecht: Die Luxemburger und der Staatsgerichtshof Bremen entscheiden gegen eine demokratische Avantgarde – Zugleich zum Demokratiedefizit in Zuwanderungsgesellschaften
Martin H. W. Möllers
Migration und Internationaler Terrorismus. Überlegungen zur Wahrnehmung von Migration als Kriminalproblem und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über eine Anknüpfung an asylerhebliche Merkmale, die den Schutz des Asylgrundrechts folgen lassen oder nicht
Robert Chr. van Ooyen
(K)ein Kopftuch für Polizistinnen? Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus pluralismustheoretischer Sicht
Robert Chr. van Ooyen
Staatliche, quasi-staatliche und nichtstaatliche Verfolgung? Hegels und Hobbes’ Begriff des Politischen in den Asyl-Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
Martin H. W. Möllers / Robert Chr. van Ooyen
Das Bundesverfassungsgericht im Politikfeld Öffentliche Sicherheit Band 3: Trennung von Polizei, Nachrichtendiensten und Militär
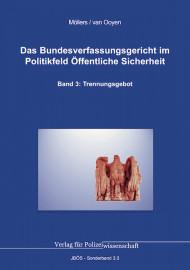
Kaum eine Materie der Verfassungsrechtsprechung hat in den letzten Jahren eine solche Spruchdichte hervorgerufen wie das Politikfeld der Öffentlichen Sicherheit. Ob Lauschangriff und Rasterfahndung, Versammlungsfreiheit und Online-Durchsuchung, ob Vorratsdatenspeicherung und Sicherungsverwahrung, Europäischer Haftbefehl und Luftsicherheitsgesetz, Bundeswehreinsatz out of area und im Innern – aber auch Grundrechtsgeltung im Ausland und „Kopftuch“ im Öffentlichen Dienst: Durch den populären Ruf nach mehr „Sicherheit“ hat sich das Bundesverfassungsgericht wie selten zuvor herausgefordert gesehen, Parlament und Regierung Grenzen zu ziehen. Dabei ist es selbst an die Grenzen der Verfassungsrechtsschöpfung gedrungen, hat zugleich erhebliche Zugeständnisse gegenüber den Sicherheitsbehörden gemacht und angesichts des Notstands in der Pandemiebekämpfung sogar die flächendeckende „Grundrechts-Suspendierung“ weitestgehend „durchgewunken“.
Diese rechtspolitische Entwicklung infolge des Paradigmenwechsels in der Öffentlichen Sicherheit ist noch nicht abgeschlossen, hat sich aber nach einer Reihe von Grundsatzentscheidungen vorerst konsolidiert, sodass eine Bestandsaufnahme möglich ist. Dabei werden Kontinuitäten und Brüche in der Rechtsprechung deutlich, die sich durch die Auseinandersetzung mit dem EuGH und EGMR in den europäischen Bereich verlängert. In den sechs Teilgebieten wird analysiert:
• die allgemeine Rechtsprechung zu den Grundrechten (Band 1),
• die Rechtsprechung zur Polizei (Band 2),
• die Rechtsprechung zur Trennung von Polizei, Nachrichtendiensten und Militär (Band 3),
• die Rechtsprechung zur Migration (Band 4),
• die Rechtsprechung zur wehrhaften Demokratie (Band 5) und
• die Rechtsprechung zu transnationalen Kontexten (Band 6).
Inhalt
Inhalt:
Robert Chr. van Ooyen
Das Bundesverfassungsgericht im Politikfeld Öffentliche Sicherheit: Von „Schleyer“ zu „Luftsicherheit“, von „Out-of-Area“ zu „Parlamentsvorbehalt ,Bundeswehreinsatz‘ G8-Gipfel“
Robert Chr. van Ooyen
„Luftsicherheit II“ als erneuter verfassungspolitischer Tabubruch. Das Bundesverfassungsgericht gibt als Ersatzverfassungsgeber auch den – (noch) beschränkten – Militäreinsatz im Innern frei
Martin H. W. Möllers
Die Verfassungswidrigkeit einzelner gesetzlicher Befugnisse des Bundeskriminalamts (BKA) zur Datenerhebung und Datenspeicherung
Martin H. W. Möllers
Neue Beschränkungen der Übermittlungs- und Abrufregelungen für Bestandsdaten durch das Bundesverfassungsgericht
Martin H. W. Möllers
Die Unvereinbarkeit der Datenerhebungs- und Übermittlungsbefugnisse des hessischen Landesamts für Verfassungsschutz mit dem Grundgesetz
Robert Chr. van Ooyen
Exkurs: Polizei, Verfassungsschutz und Organisierte Kriminalität: die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Sachsen zum Trennungsgebot
Pressemitteilung Nr. 109/2010 des Bundesverfassungsgerichts
Wohnungsdurchsuchung aufgrund einer vom Bundesnachrichtendienst (BND) im Ausland beschafften „Steuer-CD“
Pressemitteilung Nr. 85/2022 des Bundesverfassungsgerichts
Daten-Übermittlung durch Verfassungsschutzbehörden an Polizei und Staatsanwaltschaft
Martin H. W. Möllers
Öffentliche Sicherheit und Gesellschaft Politische Debatten zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 7., überarbeitete und erweiterte Auflage
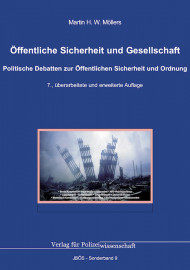
Nicht erst seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 (9/11) in den USA steht die innere und äußere Sicherheit Deutschlands im Fokus politischer Diskussionen, sondern eigentlich zu jeder Zeit. Man denke nur an den „Deutschen Herbst“ im September und Oktober 1977, der in der Bundesrepublik Deutschland durch die Terrorwelle der linksextremen Roten Armee Fraktion (RAF) geprägt war. Auch andere europäische Staaten hatten sich mit entsprechenden Terrorgruppen in ihrem Land auseinanderzusetzen.
Politische Diskussionen in der deutschen Gesellschaft wurden und werden immer durch konkrete Ereignisse ausgelöst. Denn diese finden in den Medien einen enormen Widerhall und veranlassten bisher regelmäßig Politik, Regierung, Sicherheitsbehörden und oberste Gerichte – allen voran das Bundesverfassungsgericht –, die Sicherheitsarchitektur auf Kosten der Freiheit zu verändern. Auch wenn die öffentliche Ordnung durch konkrete Ereignisse zu kippen droht, werden politische Diskussionen laut, die vor allem nach Änderungen drängen. Als zum Beispiel Mitte der 1990er Jahre die Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) immer länger dauerten und dadurch der Rechtsstaat beschädigt schien, wurden Stimmen laut, das oberste deutsche Gericht zu entlasten. Und als die erste PISA-Studie in Deutschland im Jahr der Terroranschläge 9/11 veröffentlicht wurde, kam es bei den Sicherheitsbehörden zu Diskussionen über die Lesekompetenz von Polizistinnen und Polizisten, die als Schlüsselqualifikation für den Polizeiberuf gilt. Die PISA-Studie war nur ein Anlass von vielen, die Evaluation und Neuorganisation der Sicherheitsbehörden zu fordern. Das BVerfG versuchte gleichzeitig in verschiedenen Entscheidungen, unter Wahrung der Grundrechte den Sicherheitsbehörden Entscheidungshilfen etwa zum Versammlungsverbot an die Hand zu geben, indem es sogar ein Sonderrecht bei Meinungsäußerungen von Rechtsextremisten einräumte.
Der Band behandelt folgende Ereignisse:
• Januar 1998: Die „Benda-Kommission“ präsentierte ihren Bericht zur Entlastung des BVerfG.
• Ende 2001: Veröffentlichung der ersten PISA-Ergebnisse mit schlechtem Abschneiden Deutschlands.
• Oktober 2002: Einem Kindesentführer wurde Schmerzzufügung durch die Polizei angedroht.
• März 2003: Das BVerfG wies die Anträge zum Parteiverbot der NPD zurück.
• Januar 2006: Das BVerfG hob eine Verbotsverfügung zu einer rechtsextremistischen Demonstration auf.
• Juli 2006: In Dortmund und Koblenz wurden in zwei Regionalexpresszügen Kofferbomben entdeckt.
• November 2009: Der Erste Senat des BVerfG traf zwei Entscheidungen zu Versammlungen von Rechts-extremisten in Wunsiedel und in Bielefeld.
• Mai 2010: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) beanstandete ein rechtskräftig gewordenes Urteil über die nachträgliche Verlängerung der Sicherungsverwahrung von Straftätern.
• Dezember 2010: Die „Werthebach-Kommission“ legt ihren Bericht mit Reformvorschlägen für die Polizeien des Bundes vor.
• Februar 2011: Das BVerfG stärkt das Demonstrationsrecht in Flughäfen und Bahnhöfen.
• Oktober 2014: Aus den Kriegs- und Krisengebieten des Nahen Osten und Afrikas fliehen viele Menschen nach Europa. Als „Gegenbewegung“ entwickelte sich in Deutschland eine „Demonstrationskultur“.
• Januar 2017: Das BVerfG wies erneut die Anträge zum Parteiverbot der NPD zurück.
• April 2018: Ein Jugendlicher erhielt ein bundesweites Stadionverbot, obwohl das Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs eingestellt wurde. Die Verfassungsbeschwerde wurde abgewiesen.
• Februar 2020: Die Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) „feierte“ in Dresden ihre 200. Demonstration.
Die Ereignisse und ihre Folgewirkungen untersucht der Sonderband.
Inhalt
Inhalt:
Zur Einführung: Politische Debatten zur Sicherheitspolitik seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001
Die Reformvorschläge der Benda-Kommission zur Entlastung des Bundesverfassungsgerichts von 1998 und ihre Wirkungen
PISA und Polizei – Zur Lesekompetenz im Hochschulstudium als Schlüsselqualifikation für den Polizeiberuf
Die Abwägung der Menschenwürde beim Folterverbot, beim Lauschangriff und Abhörurteil, bei der Luftsicherheit und der Einführung des neuen Gefahrenbegriffs ,drohende Gefahr‘
,Antworten auf den internationalen Terrorismus – Gewährleistung der Inneren Sicherheit durch Bund und Länder‘ – Tagungsbericht
,Rechtsprechungstradition‘, ,Zeitgeist‘ und ,Staatsräson‘ in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Versammlungsfreiheit seit dem Brokdorf-Beschluss
Der Bielefeld-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts im Lichte von ,Wunsiedel‘: Zum Sonderrecht bei Meinungsäußerungen von Rechtsextremisten
(Un-)Kooperative Sicherheit – Empfehlungen der ,Werthebach-Kommission‘ zu den Polizeien des Bundes und ihre Verpuffungen
,Täterschutz‘ vor ,Opferschutz‘ bei der nachträglichen Verlängerung der Sicherungsverwahrung? – Der Streit von EGMR gegen BVerfG und BGH und das Dilemma um eine neue Gesetzgebung für als ,gefährlich‘ geltende Straftäter
,Ein vom Elend der Welt unbeschwertes Gemüt des Bürgers ist kein Belang, zu dessen Schutz der Staat Grundrechtspositionen einschränken darf‘ – Zur Stärkung des Demonstrationsrechts in Flughäfen und Bahnhöfen durch das Bundesverfassungsgericht
,Rechtsverletzende‘ oder ,rein geistige Wirkungen‘ bei rechtspopulistischen Demonstrationen von AfD, PEGIDA & Co.
Die Problematik der Drittwirkung von Grundrechten: Zur Ausstrahlungswirkung des allgemeinen Gleichheitssatzes in das Zivilrecht im sog. ,Stadion-Urteil‘ des BVerfG 347
Martin H. W. Möllers / Robert Chr. van Ooyen
Das Bundesverfassungsgericht im Politikfeld Öffentliche Sicherheit Band 6: Transnationale Kontexte
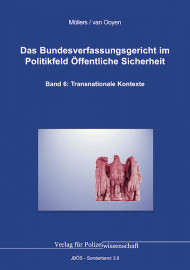
Kaum eine Materie der Verfassungsrechtsprechung hat in den letzten Jahren eine solche Spruchdichte hervorgerufen wie das Politikfeld der Öffentlichen Sicherheit. Ob Lauschangriff und Rasterfahndung, Versammlungsfreiheit und Online-Durchsuchung, ob Vorratsdatenspeicherung und Sicherungsverwahrung, Europäischer Haftbefehl und Luftsicherheitsgesetz, Bundeswehreinsatz out of area und im Innern – aber auch Grundrechtsgeltung im Ausland und „Kopftuch“ im Öffentlichen Dienst: Durch den populären Ruf nach mehr „Sicherheit“ hat sich das Bundesverfassungsgericht wie selten zuvor herausgefordert gesehen, Parlament und Regierung Grenzen zu ziehen. Dabei ist es selbst an die Grenzen der Verfassungsrechtsschöpfung gedrungen, hat zugleich erhebliche Zugeständnisse gegenüber den Sicherheitsbehörden gemacht und angesichts des Notstands in der Pandemiebekämpfung sogar die flächendeckende „Grundrechts-Suspendierung“ weitestgehend „durchgewunken“.
Diese rechtspolitische Entwicklung infolge des Paradigmenwechsels in der Öffentlichen Sicherheit ist noch nicht abgeschlossen, hat sich aber nach einer Reihe von Grundsatzentscheidungen vorerst konsolidiert, sodass eine Bestandsaufnahme möglich ist. Dabei werden Kontinuitäten und Brüche in der Rechtsprechung deutlich, die sich durch die Auseinandersetzung mit dem EuGH und EGMR in den europäischen Bereich verlängert. In den sechs Teilgebieten wird analysiert:
• die allgemeine Rechtsprechung zu den Grundrechten (Band 1),
• die Rechtsprechung zur Polizei (Band 2),
• die Rechtsprechung zur Trennung von Polizei, Nachrichtendiensten und Militär (Band 3),
• die Rechtsprechung zur Migration (Band 4),
• die Rechtsprechung zur wehrhaften Demokratie (Band 5) und
• die Rechtsprechung zu transnationalen Kontexten (Band 6).
Inhalt
Inhalt:
Martin H. W. Möllers
Die Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte im Ausland
Martin H. W. Möllers
Zur teilweisen Verfassungswidrigkeit der Strategischen Inland-Ausland-Fernmeldeüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst im Bereich Cybergefahren
Robert Chr. van Ooyen
Die EU – (k)ein System kollektiver Sicherheit? Beim Anti-IS-Einsatz der Bundeswehr (Syrien/Irak) macht das Bundesverfassungsgericht eine „europafreundliche“ Wende
Robert Chr. van Ooyen
Das Bundesverfassungsgericht als außen- und sicherheitspolitischer Akteur: Von der „Out-of-Area-“ zum „Tornado- und AWACS-Einsatz“
Martin H. W. Möllers
Die nachträgliche Verlängerung der Sicherungsverwahrung vor Gericht: Bundesverfassungsgericht gegen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) – „Täterschutz“ gegen „Opferschutz“?
Robert Chr. van Ooyen
„Zwei Senate in meiner Brust“? Die „Vorratsdatenspeicherung“ im Spiegel bisheriger Europa-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
Robert Chr. van Ooyen
Das Demokratiedefizit des EU-Haftbefehls vor dem Bundesverfassungsgericht
Martin H. W. Möllers / Robert Chr. van Ooyen
Das Bundesverfassungsgericht im Politikfeld Öffentliche Sicherheit Band 5: Wehrhafte Demokratie
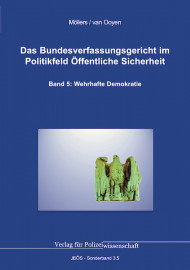
Kaum eine Materie der Verfassungsrechtsprechung hat in den letzten Jahren eine solche Spruchdichte hervorgerufen wie das Politikfeld der Öffentlichen Sicherheit. Ob Lauschangriff und Rasterfahndung, Versammlungsfreiheit und Online-Durchsuchung, ob Vorratsdatenspeicherung und Sicherungsverwahrung, Europäischer Haftbefehl und Luftsicherheitsgesetz, Bundeswehreinsatz out of area und im Innern – aber auch Grundrechtsgeltung im Ausland und „Kopftuch“ im Öffentlichen Dienst: Durch den populären Ruf nach mehr „Sicherheit“ hat sich das Bundesverfassungsgericht wie selten zuvor herausgefordert gesehen, Parlament und Regierung Grenzen zu ziehen. Dabei ist es selbst an die Grenzen der Verfassungsrechtsschöpfung gedrungen, hat zugleich erhebliche Zugeständnisse gegenüber den Sicherheitsbehörden gemacht und angesichts des Notstands in der Pandemiebekämpfung sogar die flächendeckende „Grundrechts-Suspendierung“ weitestgehend „durchgewunken“.
Diese rechtspolitische Entwicklung infolge des Paradigmenwechsels in der Öffentlichen Sicherheit ist noch nicht abgeschlossen, hat sich aber nach einer Reihe von Grundsatzentscheidungen vorerst konsolidiert, sodass eine Bestandsaufnahme möglich ist. Dabei werden Kontinuitäten und Brüche in der Rechtsprechung deutlich, die sich durch die Auseinandersetzung mit dem EuGH und EGMR in den europäischen Bereich verlängert. In den sechs Teilgebieten wird analysiert:
• die allgemeine Rechtsprechung zu den Grundrechten (Band 1),
• die Rechtsprechung zur Polizei (Band 2),
• die Rechtsprechung zur Trennung von Polizei, Nachrichtendiensten und Militär (Band 3),
• die Rechtsprechung zur Migration (Band 4),
• die Rechtsprechung zur wehrhaften Demokratie (Band 5) und
• die Rechtsprechung zu transnationalen Kontexten (Band 6).
Inhalt
Inhalt:
Martin H. W. Möllers
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Abwehrverhalten: Die Organklagen der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag wegen der Wahl und Abwahl von Ausschussvorsitzenden bleiben erfolglos
Robert Chr. van Ooyen
Rechtspolitik durch verfassungsgerichtliche Maßstabsverschiebung: Die „neue“ Definition der FdGO im NPD II-Urteil
Martin H. W. Möllers
Der Bielefeld-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts im Lichte von „Wunsiedel“: Meinungsäußerungen von Rechtsextremisten
Robert Chr. van Ooyen
Die Parteiverbotsverfahren gegen SRP und KPD: Konsolidierung und „Sündenfall“ des Bundesverfassungsgerichts in der Frühphase der Bonner Republik
Martin H. W. Möllers
Voraussetzungen, Ablauf und Rechtsfolgen von Verfahren, die zu Parteiverboten und zur Grundrechtsverwirkung vor dem Bundesverfassungsgericht führen, sowie Verfahren zu Vereinsverboten
Robert Chr. van Ooyen
„Vereinsverbote“ gegen „Scheinparteien“? – Zum NPD-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
Martin H. W. Möllers / Robert Chr. van Ooyen
Das Bundesverfassungsgericht im Politikfeld Öffentliche Sicherheit Band 1: Grundrechte Jahrbuch Öffentliche Sicherheit – Sonderband 3.1
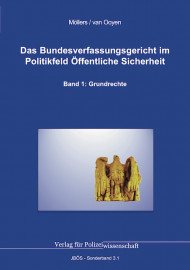
Diese rechtspolitische Entwicklung infolge des Paradigmenwechsels in der Öffentlichen Sicherheit ist noch nicht abgeschlossen, hat sich aber nach einer Reihe von Grundsatzentscheidungen vorerst konsolidiert, sodass eine Bestandsaufnahme möglich ist. Dabei werden Kontinuitäten und Brüche in der Rechtsprechung deutlich, die sich durch die Auseinandersetzung mit dem EuGH und EGMR in den europäischen Bereich verlängert. In den sechs Teilgebieten wird analysiert:
• die allgemeine Rechtsprechung zu den Grundrechten (Band 1),
• die Rechtsprechung zur Polizei (Band 2),
• die Rechtsprechung zur Trennung von Polizei, Nachrichtendiensten und Militär (Band 3),
• die Rechtsprechung zur Migration (Band 4),
• die Rechtsprechung zur wehrhaften Demokratie (Band 5) und
• die Rechtsprechung zu transnationalen Kontexten (Band 6).
Inhalt
Inhalt:
Martin H. W. Möllers / Robert Chr. van Ooyen
Bundesnotbremse – das Bundesverfassungsgericht bleibt „etatistisch“: Mehr Grundrechte, weniger Freiheit und eine „Kontrollinszenierung“?
Martin H. W. Möllers
Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei Freiheitsbeschränkungen infolge der Coronavirus SARS CoV-2 Pandemie
Robert Chr. van Ooyen
,Schönwetterdemokratie‘? – Der Grundrechte-Shutdown im Corona-Notstand als Lackmustest des Grundgesetzes
Martin H. W. Möllers
Entscheidungen des BVerfG zur Versammlungsfreiheit zwischen „Rechtsprechungstradition“, „Zeitgeist“ und „Staatsräson“
Robert Chr. van Ooyen
Der Brokdorf-Beschluss (1985) und die andere Demokratietheorie des Bundesverfassungsgerichts – Das Pluralismuskonzept des Ersten Senats (Kelsen und Popper / Hesse und Häberle) als Alternative zum Legitimationsketten-Modell (Schmitt und Böckenförde)
Martin H. W. Möllers
Schutzpflichten ohne Grenzen? Das BVerfG erweitert die Legitimationsbasis für staatliche Grundrechtseingriffe im Klimaschutz-Beschluss
Maximilian Chr. M. Möllers / Martin H. W. Möllers
Das Urteil des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit des § 217 StGB und der Grundrechtsschutz zum selbstbestimmten Tod
Martin H. W. Möllers
Die Problematik der Drittwirkung von Grundrechten: Zur Ausstrahlungswirkung des allgemeinen Gleichheitssatzes in das Zivilrecht im sog. „Stadion-Urteil“ des BVerfG
Martin H. W. Möllers
„Erhebliches Vollzugsdefizit“ bei den Absprachen im Strafprozess – Das Bundesverfassungsgericht segnet grundsätzlich den Deal im Strafprozess ab