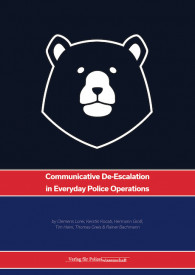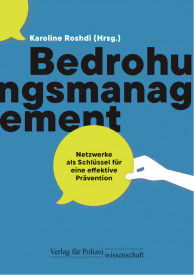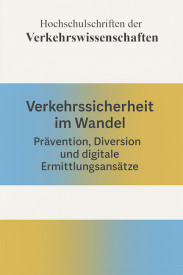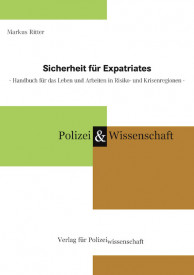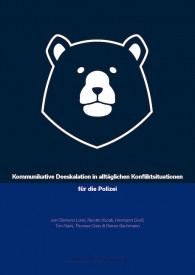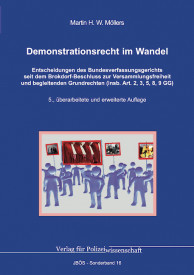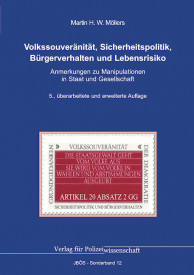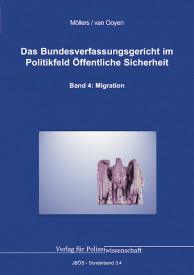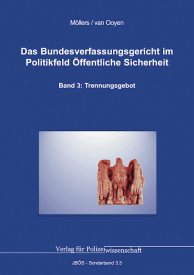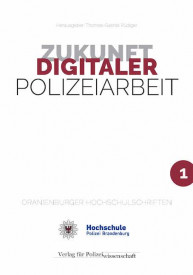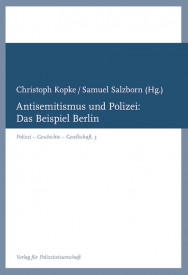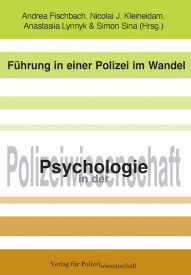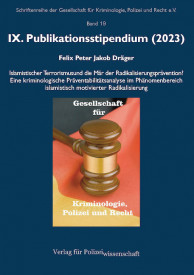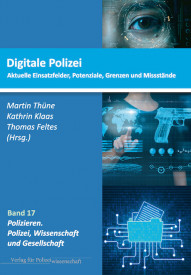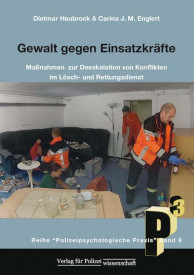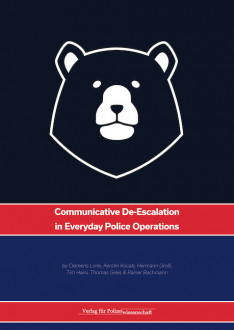
Lehrbücher
Clemens Lorei, Kerstin Kocab, Hermann Groß, Tim Haini, Thomas Greis & Rainer Bachmann
Communicative De-Escalation in Everyday Police Operations A Handbook for Users
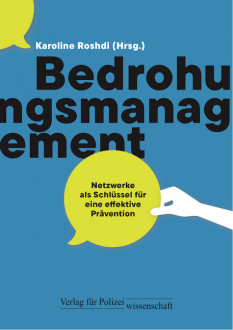
Lehrbücher
Karoline Roshdi (Hrsg.)
Bedrohungsmanagement – Netzwerke als Schlüssel für eine effektive Prävention
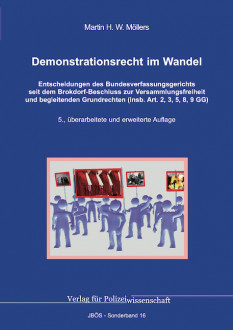
Schriftenreihen
Martin H. W. Möllers
Demonstrationsrecht im Wandel Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts seit dem Brokdorf-Beschluss zur Versammlungsfreiheit und begleitenden Grundrechten (insb. Art. 2, 3, 5, 8, 9 GG) 5., überarbeitete und erweiterte Auflage

Schriftenreihen
Martin H. W. Möllers
Volkssouveränität, Sicherheitspolitik, Bürgerverhalten und Lebensrisiko Anmerkungen zu Manipulationen in Staat und Gesellschaft 5., überarbeitete und erweiterte Auflage
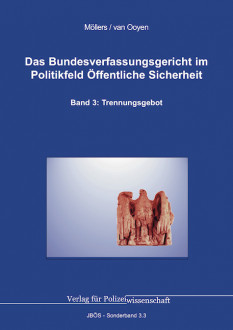
Schriftenreihen
Martin H. W. Möllers / Robert Chr. van Ooyen
Das Bundesverfassungsgericht im Politikfeld Öffentliche Sicherheit Band 3: Trennung von Polizei, Nachrichtendiensten und Militär
Clemens Lorei, Kerstin Kocab, Hermann Groß, Tim Haini, Thomas Greis & Rainer Bachmann
Communicative De-Escalation in Everyday Police Operations A Handbook for Users
 ISBN 978-3-86676-989-2
ISBN 978-3-86676-989-2
The book focuses on everyday police operations.
Inhalt
1 Table of Contents
2 Foreword
3 About the book
4 Police situation Report
4.1 Frequency and types of attacks
4.2 Typical operational situations
4.3 Typical parties to a conflict
4.4 Typical interactions
4.5 Conclusion
5 The theoretical background of de-escalation
5.1 Definition of de-escalation
5.2 The effectiveness of de-escalation
5.3 The significance of personal attitude
5.4 The police organization's self-image
6 The KODIAK framework
6.1 KODIAK's objectives
6.2 Emphasis on routine utilization
6.3 Axioms
7 The KODIAK step-by-step model
7.1 Stages
7.2 Situation assessment
7.3 Transition to coercion
8 Stages and associated de-escalation techniques
8.1 Safety
8.2 Relationship
8.3 Calming
8.4 Conflict clarification
8.5 Search for solutions
8.6 Solution Implementation
8.7 Cross-level techniques
9 Case study: KODIAK in action
10 Subsequent observation and analysis
10.1 Basics of reflection and follow-up
10.2 Schemes for follow-up
11 Suggestions for reflection
11.1 Introduction
11.2 Reflections on one's own personal attitude
11.3 Reflections on your own experiences
11.4 Reflections on your own strengths and weaknesses
11.5 Reflections on the use of force
11.6 Your own reflection topics on de-escalation
12 Implementation and exercise recommendations
12.1 Keep what has been tried and tested!
12.2 If you want something to be different, do it differently
12.3 Practice makes perfect
12.4 Persistence is the strength of the successful
12.5 Possible learning steps
13 References
14 Case studies
Karoline Roshdi (Hrsg.)
Bedrohungsmanagement – Netzwerke als Schlüssel für eine effektive Prävention
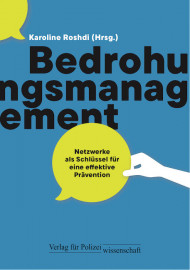 ISBN 978-3-86676-964-9
ISBN 978-3-86676-964-9
Dieses Buch vermittelt die grundlegenden Konzepte und Anwendungsbereiche des Bedrohungsmanagements. Es beleuchtet unter anderem die Themen häusliche Gewalt und Femizide, Stalking, Radikalisierung und politisch motivierte Gewalt sowie Gewalt am Arbeitsplatz („Workplace Violence“). Darüber hinaus werden bestehende Strukturen des Bedrohungsmanagements dargestellt und ihre Entwicklungen im Sinne eines best practices der letzten Jahre analysiert.
Deutlich wird: Wirksames Bedrohungsmanagement kann nicht von einer einzelnen Profession geleistet werden. Vielmehr erfordert es die enge Zusammenarbeit in regionalen wie überregionalen Netzwerken. Nur so lassen sich bedrohliche Entwicklungen frühzeitig erkennen, fundiert einschätzen und gemeinsam entschärfen.
Inhalt
Martin H. W. Möllers
Demonstrationsrecht im Wandel Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts seit dem Brokdorf-Beschluss zur Versammlungsfreiheit und begleitenden Grundrechten (insb. Art. 2, 3, 5, 8, 9 GG) 5., überarbeitete und erweiterte Auflage
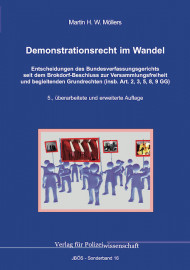 ISBN 978-3-86676-961-8
ISBN 978-3-86676-961-8
Versammlungen unter freiem Himmel haben sich aufgrund des Erstarkens rechtsextremistischer, fremdenfeindlicher Tendenzen in der Bevölkerung in letzter Zeit erheblich quantitativ vermehrt. Neben „Reichsbürgern“, die sich nicht nur durch Aufmärsche hervortaten, sondern bereits zweimal einen Staatsstreich planten, „Pegida“ und ihre Ableger und insbesondere die AfD, die inzwischen als gesichert rechtsextremistisch vom Bundesamt für Verfassungsschutz eingestuft wurde, sowie das Netzwerk jugendlicher, gewaltbereiter Rechtsextremisten, die sich in friedliche Versammlungen anderer einschleichen, sind dafür beredtes Beispiel. Die „Gegenbewegungen“ gestalten zwar bürgerliche Kreise. Ihre Wahrnehmung geht aber in der Öffentlichkeit durch Gewaltexzesse dieser rechts- und der linksextremistischen Szene (Autonome) unter. Die Polizei rüstet auf – zum Unmut von dadurch in ihren Grundrechten betroffenen Menschen.
In den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Versammlungsfreiheit spielen „Rechtsprechungstradition“, „Staatsräson“ und auch der „Zeitgeist“ eine wesentliche Rolle. Denn auch das Recht spiegelt lediglich eine aktuelle politische Situation wider, welche die Gesetzgeber durch ihr Gesetz beherrschen wollen. Und Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts sind ebenfalls nicht frei von Beeinflussung durch ihre Umwelt. Sie scheuen sich nicht, eigene rechtspolitische Auffassungen in ihren Entscheidungen unterzubringen, mit denen sie auch Rechtstraditionen durchbrechen.
Anhand vieler Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Versammlungsfreiheit sowie den mit der Versammlungsfreiheit im Zusammenhang stehenden Grundrechten lässt sich deutlich erkennen, dass beide Senate zwischen dem Schutz der Grundrechte und der Funktionsfähigkeit des Staates oszillieren.
Das Buch dokumentiert auszugsweise ausgewählte Entscheidungen zur Versammlungsfreiheit und weist den Gerichtsentscheidungen in der Kommentierung „Rechtsprechungstradition“, „Staatsräson“ und „Zeitgeist“ nach.
Inhalt
Inhalt:
Einführung
Das Demonstrationsrecht und die Grundrechte-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
1 Das Staatsverständnis des Bundesverfassungsgerichts zu den Grundrechten als Leitlinien für die Exekutive
2 Verdeckte Vorfeldermittlungen im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz als Gefahr für die Beschränkung der Versammlungsfreiheit
Brokdorf-Beschluss
,Rechtsprechungstradition‘, ,Zeitgeist‘ und ,Staatsräson‘ in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Versammlungsfreiheit seit dem Brokdorf-Beschluss
1 Dokumentation BVerfGE 69, 315-372 –Brokdorf-Beschluss [Auszug]
2 Die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit in der vorkonstitutionellen deutschen Tradition
3 Der Brokdorf-Beschluss als Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts
4 Die Folgewirkungen des liberalen Brokdorf-Beschlusses auf spätere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Versammlungsfreiheit
Wunsiedel- und Bielefeld-Beschlüsse
Das Sonderrecht bei Meinungsäußerungen von Rechtsextremisten im Wunsiedel-Beschluss in Gegenüberstellung mit dem Bielefeld-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
1 Dokumentation BVerfG, 1 BvR 2150/08 vom 4.11.2009, Rn. 1-110 – Wunsiedel-Beschluss [Auszug]
2 Dokumentation BVerfG, 1 BvR 2636/04 vom 12.5.2010, Rn. 1-32 – Bielefeld-Kammerbeschluss [Auszug]
3 Einführende kurze Anmerkungen zu beiden Entscheidungen
4 Die Entscheidungsbedeutung des Wunsiedel-Beschlusses
5 Der Bielefeld-Beschluss im Lichte von ,Wunsiedel‘
6 Quintessenz und Ausblick
,Rechtsverletzende‘ oder ,rein geistige Wirkungen‘ von rechtspopulistischen Demonstrationen – Zu den auf deutscher Rechtstradition basierenden rechtlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für Versammlungen von AfD und anderen rechtsextremistischen Gruppen
1 Einleitung zur Historie des Versammlungsrechts und zur Vorgehensweise
2 Die Bedeutung der Grundrechte als ,oberste Prinzipien‘
3 Die Versammlungsfreiheit in der vorkonstitutionellen deutschen Tradition
4 Die Versammlungsfreiheit in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
5 Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu ,rechtsverletzenden‘ und ,rein geistigen Wirkungen‘
6 Zusammenfassung und Ausblick
Fraport-Entscheidung
Die Fraport-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Stärkung des Demonstrationsrechts auf Flughäfen, Bahnhöfen und in Einkaufszentren
1 Dokumentation BVerfG, 1 BvR 699/06 vom 22.2.2011, Rn. 1-128 – Fraport-Urteil [Auszug]
2 Die Ausgangslage der gerichtlichen Entscheidung
3 Die Leitsätze
4 Keine Begrenzung des Schutzbereichs der Meinungsfreiheit auf öffentliche, der Kommunikation dienende Foren
5 Prognosen aus dem Urteil
Polizeikessel-Kammerbeschluss
Abkehr vom liberalen Brokdorf-Beschluss? Die Kammer-Entscheidung des BVerfG zur Rechtmäßigkeit eines Polizeikessels vom 2.11.2016
1 Dokumentation BVerfG, 1 BvR 699/06 vom 22.2.2011, Rn. 1-128 – Polizeikessel-Beschluss [Auszug]
2 Einleitung zur Problematik
3 Grundlagen des Brokdorf-Beschlusses
4 Die Einkesselung als Grundrechtsproblem
5 Beurteilung des dem BVerfG vorliegenden Sachverhalts durch die Kammer
6 Bewertung des Kammerbeschlusses zum Polizeikessel und Ausblick
Identitätsfeststellungen auf Versammlungen
Hürde für die Polizei im Demonstrationsrecht: Identitätsfeststellung im Rahmen einer Versammlung erfordert konkrete Gefahr für ein polizeiliches Schutzgut
1 Einleitung zur Problematik der Identitätsfeststellung
2 Hintergrund der Entscheidung und kritische Anmerkungen gegen die Begründung der Instanzengerichte
3 Erläuternde Begründung der Entscheidung der Kammer
Stadionverbot-Urteil
Die Problematik der Drittwirkung von Grundrechten: Zur Ausstrahlungswirkung des allgemeinen Gleichheitssatzes in das Zivilrecht im sog. ,Stadionverbot-Urteil‘ des BVerfG
1 Einführung zur Problematik der Drittwirkung von Grundrechten
2 Zur Ausstrahlungswirkung des allgemeinen Gleichheitssatzes in das Zivilrecht
3 Dokumentation: Stadionverbotsbeschluss des BVerfG vom 11. April 2018 - 1 BvR 3080/09 - Rn. 1-58 [Auszüge]
Entscheidungen in der Corona-Krise
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in der Corona-Krise in Gegenüberstellung zu Urteilen der Verwaltungsgerichte
1 Einführung zur Problematik der staatlichen Maßnahmen in der Corona-Pandemie
2 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu den ersten Verfassungsbeschwerden im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie
3 Entscheidungen von Verwaltungsgerichten zu einzelnen Maßnahmen
4 Kammerbeschlüsse des BVerfG zu einzelnen Maßnahmen
5 Uneinheitlichkeit bei den Gerichtsentscheidungen und den Verordnungen der Landesregierungen bezüglich des Verbots, Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche mit mehr als 800 m2 zu öffnen
6 Verfassungsgerichtliche Entscheidungen zu den ersten ,Lockerungen‘ von Freiheitsbeschränkungen nach Beschluss von Bund und Ländern
Martin H. W. Möllers
Volkssouveränität, Sicherheitspolitik, Bürgerverhalten und Lebensrisiko Anmerkungen zu Manipulationen in Staat und Gesellschaft 5., überarbeitete und erweiterte Auflage
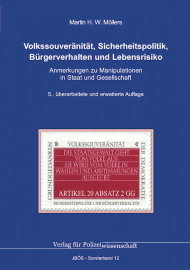 ISBN 978-3-86676-951-9
ISBN 978-3-86676-951-9
Inhalt
Inhalt:
Einführung zu den Theorien über Manipulationen von Staat und Gesellschaft
Volkssouveränität
Prinzipien der Volkssouveränität und ihre Entwicklung im 21. Jahrhundert unter Berücksichtigung sicherheitspolitischer Aspekte
Staat oder Verfassung – politische Einheit oder pluralistische Gesellschaft? Der Begriff des Staatsvolks aus verfassungstheoretischer Sicht
Sicherheitspolitik
Organisation und Vernetzung der Sicherheitsarchitektur in Deutschland
Die Sicherungsverwahrung als Spielball von Politik und Rechtsprechung
Freiheitsbeschränkungen infolge der Coronavirus SARS CoV-2 Pandemie – Willkür oder Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit?
Bürgerverhalten
Das traditionelle Bürgerverhalten, die politische Kultur in Deutschland
Lebensrisiko
Die Unantastbarkeit der Menschenwürde – keine Abwägung Leben gegen Leben
Die gesteuerte Wahrnehmung von Risiken in der Bevölkerung als Motor der Sicherheitsarchitektur
Martin H. W. Möllers / Robert Chr. van Ooyen
Das Bundesverfassungsgericht im Politikfeld Öffentliche Sicherheit Band 3: Trennung von Polizei, Nachrichtendiensten und Militär
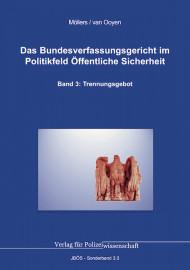 ISBN 978-3-86676-949-6
ISBN 978-3-86676-949-6
Kaum eine Materie der Verfassungsrechtsprechung hat in den letzten Jahren eine solche Spruchdichte hervorgerufen wie das Politikfeld der Öffentlichen Sicherheit. Ob Lauschangriff und Rasterfahndung, Versammlungsfreiheit und Online-Durchsuchung, ob Vorratsdatenspeicherung und Sicherungsverwahrung, Europäischer Haftbefehl und Luftsicherheitsgesetz, Bundeswehreinsatz out of area und im Innern – aber auch Grundrechtsgeltung im Ausland und „Kopftuch“ im Öffentlichen Dienst: Durch den populären Ruf nach mehr „Sicherheit“ hat sich das Bundesverfassungsgericht wie selten zuvor herausgefordert gesehen, Parlament und Regierung Grenzen zu ziehen. Dabei ist es selbst an die Grenzen der Verfassungsrechtsschöpfung gedrungen, hat zugleich erhebliche Zugeständnisse gegenüber den Sicherheitsbehörden gemacht und angesichts des Notstands in der Pandemiebekämpfung sogar die flächendeckende „Grundrechts-Suspendierung“ weitestgehend „durchgewunken“.
Diese rechtspolitische Entwicklung infolge des Paradigmenwechsels in der Öffentlichen Sicherheit ist noch nicht abgeschlossen, hat sich aber nach einer Reihe von Grundsatzentscheidungen vorerst konsolidiert, sodass eine Bestandsaufnahme möglich ist. Dabei werden Kontinuitäten und Brüche in der Rechtsprechung deutlich, die sich durch die Auseinandersetzung mit dem EuGH und EGMR in den europäischen Bereich verlängert. In den sechs Teilgebieten wird analysiert:
• die allgemeine Rechtsprechung zu den Grundrechten (Band 1),
• die Rechtsprechung zur Polizei (Band 2),
• die Rechtsprechung zur Trennung von Polizei, Nachrichtendiensten und Militär (Band 3),
• die Rechtsprechung zur Migration (Band 4),
• die Rechtsprechung zur wehrhaften Demokratie (Band 5) und
• die Rechtsprechung zu transnationalen Kontexten (Band 6).
Inhalt
Inhalt:
Robert Chr. van Ooyen
Das Bundesverfassungsgericht im Politikfeld Öffentliche Sicherheit: Von „Schleyer“ zu „Luftsicherheit“, von „Out-of-Area“ zu „Parlamentsvorbehalt ,Bundeswehreinsatz‘ G8-Gipfel“
Robert Chr. van Ooyen
„Luftsicherheit II“ als erneuter verfassungspolitischer Tabubruch. Das Bundesverfassungsgericht gibt als Ersatzverfassungsgeber auch den – (noch) beschränkten – Militäreinsatz im Innern frei
Martin H. W. Möllers
Die Verfassungswidrigkeit einzelner gesetzlicher Befugnisse des Bundeskriminalamts (BKA) zur Datenerhebung und Datenspeicherung
Martin H. W. Möllers
Neue Beschränkungen der Übermittlungs- und Abrufregelungen für Bestandsdaten durch das Bundesverfassungsgericht
Martin H. W. Möllers
Die Unvereinbarkeit der Datenerhebungs- und Übermittlungsbefugnisse des hessischen Landesamts für Verfassungsschutz mit dem Grundgesetz
Robert Chr. van Ooyen
Exkurs: Polizei, Verfassungsschutz und Organisierte Kriminalität: die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Sachsen zum Trennungsgebot
Pressemitteilung Nr. 109/2010 des Bundesverfassungsgerichts
Wohnungsdurchsuchung aufgrund einer vom Bundesnachrichtendienst (BND) im Ausland beschafften „Steuer-CD“
Pressemitteilung Nr. 85/2022 des Bundesverfassungsgerichts
Daten-Übermittlung durch Verfassungsschutzbehörden an Polizei und Staatsanwaltschaft