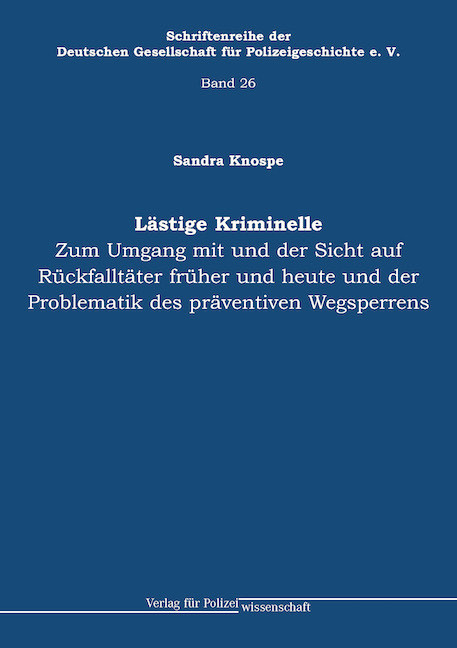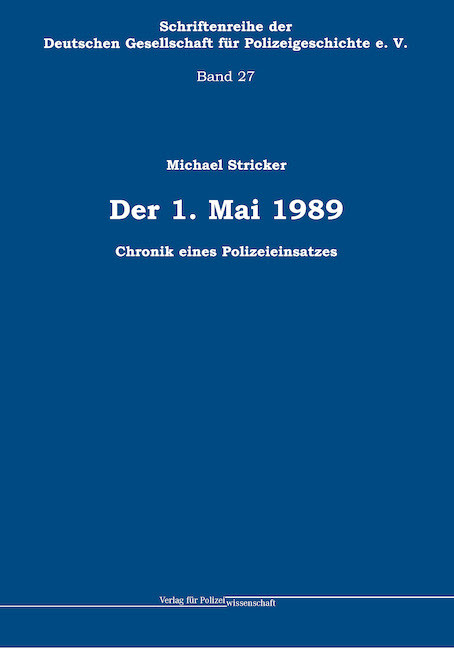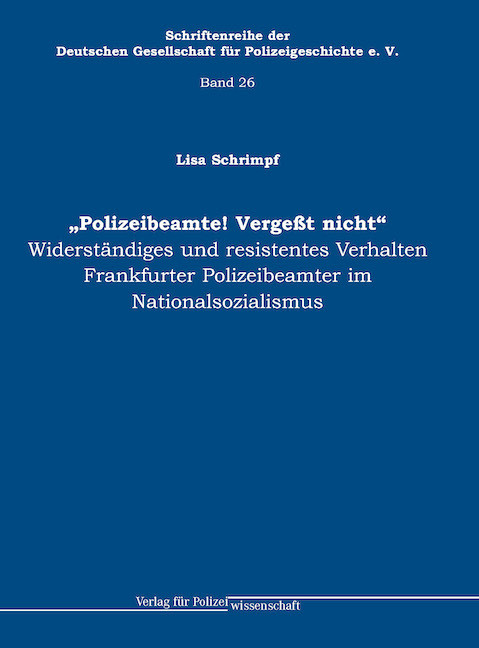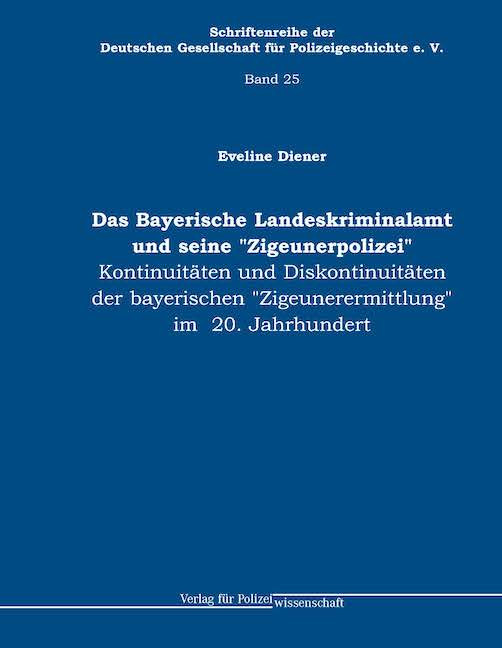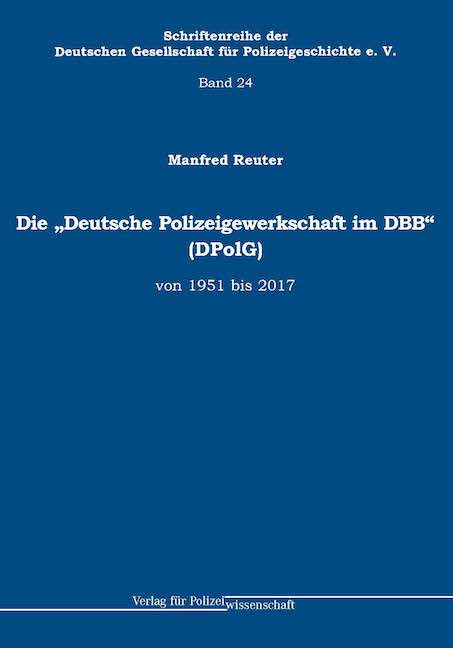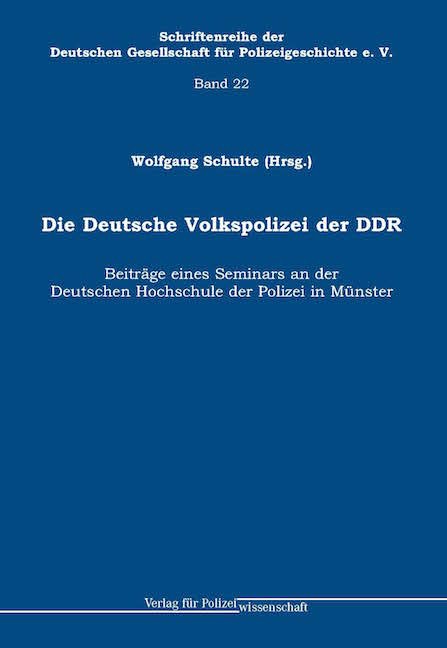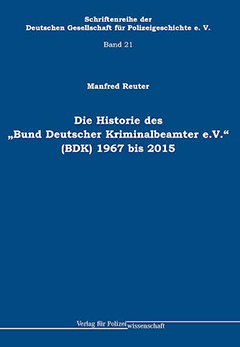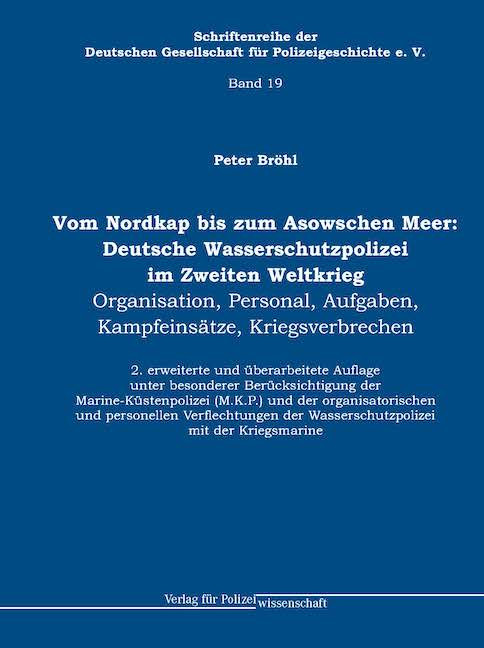Sandra Knospe
Lästige Kriminelle Zum Umgang mit und der Sicht auf Rückfalltäter früher und heute und der Problematik des präventiven Wegsperrens
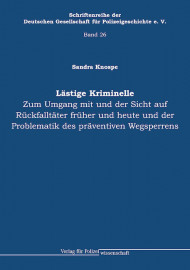
Reinhold Knospe, ein Betrüger im Rückfall, wird im Jahr 1940 zu Sicherungsverwahrung verurteilt. Durch die NS-Aktion „Vernichtung durch Arbeit“ gerät er in Konzentrationslager. Ihm gelingt das Überleben. Doch selbst seine KZ-Haftzeit mit ihren grausamen Ereignissen wird ihn nach dem Krieg nicht vom Betrügen abhalten.
Sein Lebensweg und die Beschäftigung mit der so genannten Rückfallkriminalität liegen diesem Buch zugrunde. Sein Schicksal ist kein Einzelfall.
Bei der Kriminalitätsbekämpfung spielen neben Polizei und Justiz auch die Wissenschaft, Politik, sowie Medien und die Gesellschaft eine Rolle.
Die Frage, wie Täter von einer Tatbegehung wirksam abgehalten werden können und welche Einflussfaktoren bei der Kriminalitätsbekämpfung zum Tragen kommen, ist auch heute aktuell. Eine Sicherungsverwahrung gibt es bis heute, wenn auch in modifizierter Form.
Inhalt

Am 29. Januar 1989 fand in Berlin (West) die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin statt. Hierbei kam es zu erheblichen Stimmenverlusten und letztlich zur Abwahl des Senats von CDU und FDP. Der neue rot-grüne Senat aus SPD und Alternativer Liste war nach der Wahl von Walter Momper am 16. März 1989 zum neuen Regierenden Bürgermeister erst sechs Wochen im Amt, als erneut der 1. Mai und ein damit prognostizierbar schwerer Polizeieinsatz bevorstand.
Berlin (West) war seit Anbeginn der 1980er-Jahre eine Hochburg der Hausbesetzerszene. Hierbei war der Stadtbezirk Kreuzberg besonders herausragend. In ihm hatte sich seit Jahren eine starke, politisch linksorientierte Szene entwickelt, die im bewussten Widerspruch zu den etablierten Parteien stand. Dazu gehörte auch eine neue gewaltbereite Personengruppe, die sich selbst als Autonome bezeichnete.
Die Bevölkerung von Kreuzberg war von einer hohen Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichem Niedergang geprägt. Deren Wohnumfeld bestand oftmals großflächig aus einer überalterten und entsprechend nicht saniertem Gebäudesubstanz. Daraus resultierte, dass in Kreuzberg meist ärmere Bevölkerungsgruppen wohnten, zu denen neben den gering verdienenden Arbeitern auch Studenten und Migranten zählten. Die linke Politszenerie entwickelte darin ein Eigenleben und eine Art Parallelgesellschaft, worin und woraus sie ihr Unterstützerpotential zog. Dies wirkte sich als Magnet für Gleichgesinnte aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland aus. Da es in Berlin (West) aufgrund des bestehenden Vier-Mächte-Status keine Wehrpflicht gab, zogen Personen gerade deshalb in diese Stadt und vor allem nach Kreuzberg.
Am 1. Mai 1987 kam es in Kreuzberg erstmalig zu erheblichen Ausschreitungen, die beim Straßenfest am Lausitzer Platz begannen. Dabei explodierte regelrecht die Stimmung und es begann ein verbissener Straßenkampf mit der Polizei, der ein ungeahntes Ausmaß an Gewalt und Zerstörung mit sich zog.
Während es am 1. Mai 1988 gelang, die Ausschreitungen des Vorjahres in zeitlicher und flächenmäßiger Ausbreitung zu verringern, stand der 1. Mai 1989 für die Polizei Berlin unter einer nunmehr neuen politischen Ägide. Die Einsatzplanung der Polizei für die „Revolutionäre 1. Mai-Demonstration“ sah demnach vor, dass der Aufzug nur mit schwachen Polizeikräften an der Spitze und am Schluss begleitet werden sollte. Eine seitliche Begleitung, insbesondere von erkanntem, autonomem Gewaltpotential, sollte vorerst unterbleiben, um nicht möglicherweise provozierend zu wirken.
Stattdessen sollten Polizeikräfte in den Seitenstraßen parallel zum Aufzug mitgeführt und bereitgehalten werden. Entlang der Aufzugsstrecke erfolgten mehrfach Sachbeschädigungen und Plünderungen durch autonome Klientel. Die herangeführten Polizeieinheiten konnten dies nicht verhindern. Nach Ende des Aufzuges am Hermannplatz im Stadtbezirk Neukölln strömten größere Gruppen von Gewalttätern nach Norden in Richtung Kreuzberg. Entgegen der polizeilichen Erwartungen erfolgten, gewissermaßen in einem fließenden Übergang, weitere Sachbeschädigungen, Plünderungen und jetzt auch sehr gezielte Angriffe gegen Polizeikräfte, die vielerorts personell unterlegen waren. Was folgte, waren erneut schwerste Ausschreitungen in Kreuzberg, die das Ausmaß der Sachschäden, aber insbesondere die Anzahl der verletzten Polizeibeamten der beiden Vorjahre bei weitem überstiegen. Es kam mehrfach zu Einsatzsituationen, wo einzelne Beamte bereits die Schusswaffe in der Hand hielten und viele sich in unmittelbarer Lebensgefahr befanden.
Der Polizeieinsatz anlässlich der Ausschreitungen am 1. Mai 1989 findet nur in den Onlinearchiven von manchen Zeitungen, in linker Szeneliteratur und in wenigen Büchern eine Erwähnung. Eine detaillierte Darstellung der Geschehnisse fehlte bisher. Dieses Buch stellt sich dieser Aufgabe und zeigt in sechs Kapiteln, wie es zu diesem Polizeieinsatz kam, einen zeitlichen Ablauf der Ereignisse und welche Erfahrungen die Polizei daraus entnahm. Ergänzt wird die Einsatzdokumentation durch die Darstellung der Struktur der beteiligten Polizeikräfte sowie ihrer Ausrüstung und Fahrzeuge. Durch eine große Anzahl von Kartenskizzen und Abbildungen wird der Polizeieinsatz in seinen Einzelheiten illustriert.
Inhalt
Inhalt:
Vorgeschichte
1. Einsatzkräfte und Einsatzmittel
2. Einsatzvorbereitungen und Einsatzkonzeption
3. Einsatzverlauf: Montag, 1. Mai 1989
4. Einsatzverlauf: Dienstag, 2. Mai 1989
5. Einsatznachbereitung
6. Einsatzfolgezeit und Nachwort
Hauptquellenverzeichnis
Lisa Schrimpf
„Polizeibeamte! Vergeßt nicht“ Widerständiges und resistentes Verhalten Frankfurter Polizeibeamter im Nationalsozialismus

Die Deutsche Polizei war maßgeblich an den Verbrechen der Shoah beteiligt und für die Verfolgung und Ermordung von nicht zur „Volksgemeinschaft“ gehörenden Menschen verantwortlich. Es scheint daher schwer vorstellbar, dass es innerhalb dieser Täterorganisation Personen gab, die Verfolgten und Diskriminierten Hilfe zu Teil werden ließen und ihnen damit oftmals das Leben retteten. Die vorliegende Arbeit schließt an die wenigen bereits existierenden Studien zu widerständigen Polizisten in der Zeit des Nationalsozialismus an und untersucht sechs Fälle aus dem Umkreis der Frankfurter Polizei. Dabei werden sowohl die Ordnungspolizei als auch die Sicherheitspolizei in den Blick genommen, nach Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Nachkriegszeit gefragt und die Sozialisation der betreffenden Männer berücksichtigt. Gleichzeitig erfolgt eine kritische Reflektion des Widerstandsbegriffes und der Frage nach alternativen Kategorisierungen. Zentral sind die immer wieder auftretenden Ambivalenzen zwischen Resistenz und Konformität, zwischen Widerständigkeit und Täterschaft. Die Rekonstruktion der einzelnen Biographien ermöglicht dabei einen Einblick in die damalige Lebenswelt der Polizisten und zeigt, welche Handlungsspielräume innerhalb der Frankfurter Polizei existierten.
Inhalt
Inhalt:
1. Einleitung: „Polizeibeamte! Vergeßt nicht“
2. Die Frankfurter Polizei und der Nationalsozialismus
2.1. Die Herausbildung der Ordnungs- und Sicherheitspolizei
2.2. Der Aufbau der Frankfurter Gestapo
3. „Kraft meiner Stellung“: Erste Formen der Hilfe für politisch und „rassisch“ Verfolgte
3.1. Rettung einer jüdischen Familie
3.2. Die Verbreitung und Vernichtung interner Dokumente
4. „Auf dem Boden der Demokratie“: Der Leuschner-Kreis als gewerkschaftlicher Arm des 20. Juli
4.1. Zwei Rädchen im Uhrwerk
4.2. Rettungswiderstand und Konspiration in der Frankfurter Sicherheitspolizei
5. „Kolossale Verbindungen zu Leuten“: Der Kreis Rub als transnationales Netzwerk
5.1. Polizeiliche Quereinsteiger im Widerstand
5.2. Passangelegenheiten und Handlungen in der Peripherie des 20. Juli
6. Der Umgang mit den Taten nach 1945
6.1. Entnazifizierung und Meldebögen
6.2. Spruchkammerverfahren
7. Fazit: Ambivalenter (Non-)Konformismus
8. Quellen-, Literatur- und Abbildungsnachweis
Eveline Diener
Das Bayerische Landeskriminalamt und seine "Zigeunerpolizei" Kontinuitäten und Diskontinuitäten der bayerischen "Zigeunerermittlung" im 20. Jahrhundert
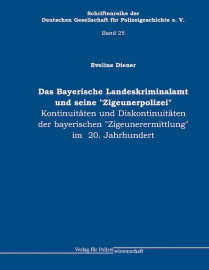
Die spezifisch genozidale Ausprägung der nationalsozialistischen Verfolgung der „Zigeuner“ fand in der Geschichtswissenschaft und in der medialen Öffentlichkeit erst vergleichsweise spät Beachtung. Dem spielte zu, dass eine entrechtende „Zigeunerpolitik“ und „Zigeunerverfolgung“ lange Zeit als normal angesehen wurde. Diese Problematik wird am Beispiel der für die „Zigeuner“- bzw. „Landfahrerermittlung“ zuständigen Stelle des 1946 gegründeten Bayerischen Landeskriminalamts untersucht. Hier werden Kontinuitäten sowie Diskontinuitäten in „Zigeunerpolitik“ bzw. „Zigeunerverfolgung“ auf der Zeitschiene „Kaiserreich“, „Weimarer Republik“, „Nationalsozialismus“ und „Nachkriegszeit“ aufgezeigt. Dafür werden zwei Forschungsschwerpunkte zusammengeführt: Die Untersuchung der einschlägigen Vorgeschichte – angefangen vom Kaiserreich bis zum Nationalsozialismus – und schließlich die Untersuchung der personellen, inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung der „Zigeuner“- bzw. „Landfahrerstelle“ des Bayerischen Landeskriminalamts der Nachkriegszeit. Hierbei liegt der Fokus auf Prägungen und Laufbahnen der dort tätigen Beschäftigten, auf gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren sowie schließlich auf langfristig geprägten Strukturen und Mentalitäten in „Zigeunerpolitik“ und „Zigeunerermittlung“.
Somit leistet die Arbeit eine Forschungsbereicherung auf dem bisher noch wenig untersuchten Gebiet der „Zigeuner“- bzw. „Landfahrerermittlung“.
Inhalt
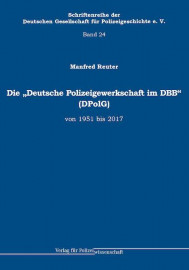
Heute dominieren in der Bundesrepublik drei Polizeigewerkschaften die Interessenvertretung der Beschäftigten in den Polizeien des Bundes und der Länder. Dies sind die „Gewerkschaft der Polizei“ (GdP), der „Bund Deutscher Kriminalbeamter“ (BDK) sowie die „Deutsche Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund“ (DPolG).
Es gibt nur wenige wissenschaftliche Arbeiten über diese Polizeigewerkschaften, wobei zur DPolG so gut wie keine Literatur existiert. Auch ist die diesbezügliche Quellenlage sehr spärlich. Diese bedauerliche Lücke soll mit der vorgelegten Monographie ein wenig geschlossen werden.
Nach der thematischen Einleitung wird im 2. Kapitel ausführlich die chronologische Entwicklung der DPolG nachgezeichnet: Vorgeschichte im Kaiserreich und der Weimarer Republik bis 1933, Unterbrechung durch den Nationalsozialismus bis 1945, Vorgängerorganisationen BDP und PDB seit 1951, Zusammenschluss 1966 als PDB, namentliche Umbenennung 1987 in DPolG, Vereinigung mit der ostdeutschen DVPolG 1991, Vereinigung mit dem Bundesgrenzschutzverband 2011.
Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst, politikwissenschaftlich anhand von bis heute virulenten Konfliktlinien eingeordnet sowie ein Ausblick gewagt und noch offene Fragen angesprochen.
Die Arbeit schließt mit einem Abkürzungs- und Quellen-/ Literaturverzeichnis.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Erkenntnisinteresse
1.2 Sozialwissenschaftlicher Forschungsstand über Polizeigewerkschaften
1.3 Literatur- und Quellenlage zur DPolG
1.4 Gliederung
2 Chronik der DPolG
2.1 Die Vorgeschichte (1882 bis 1950)
Kaiserreich (1882 - 1918)
Weimarer Republik (1919 - 1932)
NS-Zeit (1933 - 1945) … 18
Besatzungszeit (1945 - 1950)
2.2 BDP und PDB (1951 - 1965)
2.3 Zusammenschluss als PDB (1966 - 1986)
2.4 Umbenennung in DPolG (1987 - 1991)
2.5 Die DPolG nach der Wiedervereinigung (1991 - 2017)
3 Schlussbetrachtungen
3.1 Zusammenfassung
3.2 Politikwissenschaftliches Fazit
3.3 Offene Fragen / Ausblick
4 Abkürzungsverzeichnis
5 Quellen/Literatur
Wolfgang Schulte (Hrsg.)
Die Deutsche Volkspolizei der DDR – Beiträge eines Seminars an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster
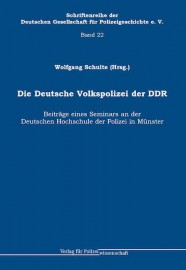
Inhalt
Inhalt:
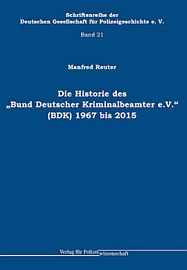
Band 21
Der „Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V.“ (BDK) ist neben der „Gewerkschaft der Polizei“ (GdP) und der „Deutschen Polizeigewerkschaft“ (DPolG) eine der drei großen und politisch relevanten Polizeigewerkschaften in Deutschland.
Während sozialwissenschaftliche Forschung über die deutschen Polizeigewerkschaften zumindest in Ansätzen vorhanden ist, bleibt der BDK dabei weitestgehend unbeachtet. Mit dieser Studie soll diese Forschungslücke geschlossen werden.
Dazu wird die historische Entwicklung des Verbandes von 1967 bis 2015 chronologisch nachgezeichnet. über die Jahre zeigen sich dabei folgende Entwicklungsphasen: Vorgeschichte, Gründung, Aufbau, Ausbau, Entwicklung, Stagnation/Krise, Aufschwung, Festigung, Vereinigung, Generationswechsel, Europäisierung und Modernisierung.
Diese verbandlichen Entwicklungsphasen werden erstens derjenigen des gesamten Polizeigewerkschaftssystems in der Bundesrepublik gegenüber gestellt.
Zweitens zeigt die Einordnung des BDK anhand eines Konfliktlinien-Modells für die Entstehung und Ausdifferenzierung des deutschen Polizeigewerkschafts-Systems folgendes Ergebnis: Der Verband ist eine Polizeigewerkschaft für die Sparte der Kriminalpolizei. Er vertritt den Gedanken einer Einheitsgewerkschaft und ist am Berufsverbandsprinzip orientiert. Er tritt für eine staatlich-nationale Polizei mit Kripo, BKA und Bundespolizei sowie eine staatlich-föderale Schutzpolizei ein. Der BDK organisiert alle Dienstgrade und alle Beschäftigten der Kriminalpolizei. National ist er als Einheitsverband organisiert und gehört keinem Dach- oder Spitzenverband an. International ist er in die CESP eingebunden. Er pflegt grundsätzlich ein distanziert-kooperatives Verhältnis zu den jeweiligen Regierungen.
Inhalt
Inhalt:
1 Einleitung
Problemstellung und Erkenntnisinteresse
Sozialwissenschaftlicher Forschungsstand
Literatur
Gliederung
2 Chronik des BDK
2.1 Vorgeschichte
2.2 Gründungsphase
2.3 Aufbauphase
2.4 Ausbauphase
2.5 Entwicklungsphase
2.6 Stagnations-/Krisenphase
2.7 Aufschwungphase
2.8 Festigungsphase
2.9 Vereinigungsphase
2.10 Generationswechsel
2.11 Europäisierungsphase
2.12 Modernisierungsphase
3 Vorsitzende des BDK
4 Schlussbetrachtungen
Zusammenfassung
Sozialwissenschaftliches Fazit
Offene Fragen
Peter Bröhl
Vom Nordkap bis zum Asowschen Meer: Deutsche Wasserschutzpolizei im Zweiten Weltkrieg Organisation, Personal, Aufgaben, Kampfeinsätze, Kriegsverbrechen
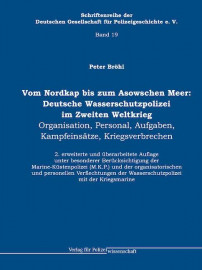
Die Wasserschutzpolizei des Deutschen Reiches wurde bereits wenige Tage nach Beginn des deutschen Überfalls auf Polen nach dort entsandt. Mit Fortgang des Krieges fanden sich deutsche Wasser-schutzpolizisten in nahezu allen von den deutschen Truppen besetzten Ländern wieder.
Neben „klassischen“, also schifffahrtsbezogenen Aufgaben, wurde die Wasserschutzpolizei allerdings auch – und im Bereich von Weißrussland und der Ukraine überwiegend – zur Bekämpfung von „Partisanen“ eingesetzt. Dass solche Einsätze nicht nur durch Polizeibataillone oder Kräfte der SS und des SD, sondern auch durch die Wasser-schutzpolizei durchgeführt wurden, ist daher insbesondere bei dem SW.-Kommando „Dnjepr“ durch Beurteilungsaussagen für den Kommandeur des Kommandos, durch den Inhalt von Ordens-vorschlägen für ehemalige Angehörige des Kommandos, durch Berichte in der damaligen Fachzeitschrift „Die Deutsche Polizei“ und durch Erkenntnisse hinsichtlich des Massakers in dem weißrussischen Dorf Wulka, sicher belegt.
Zweifelsfrei belegt sind darüber hinaus die Erschießung von 23 Dorf- bewohnern und eines Partisanenangehörigen in dem serbischen Dorf Velico-Gradiste durch Angehörige der SW.-Flottille „Serbien“ sowie die Erschießung von zehn niederländischen Bürgern in dem kleinen Ort Doniaga durch Angehörige des SW.-Kommandos „IJsselmeer“.
Damit muss festgestellt werden, dass auch die Wasserschutzpolizei während des Zweiten Weltkriegs Kriegsverbrechen begangen hat. Auch die damalige Wasserschutzpolizei war, ebenso wie andere Sparten der Polizei, durch das NS-Regime zur Durchführung staatlich gewollter Verbrechen instrumentalisiert worden. Sie war damit ebenfalls eine Stütze des verbrecherischen Systems.
Mit der vorliegenden Arbeit wurde dieses Thema – soweit bisher bekannt – erstmals im deutschsprachigen Raum aufgearbeitet.
Inhalt
Teil 1 Die deutschen Wasserschutzpolizei im auswärtigen Einsatz:
Organisation, Personal, Aufgaben und Kampfeinsätze
1.1 Die einzelnen SW.-Kommandos und SW.-Flottillen, Personalbeschaffung und Personalverluste
1.2 Österreich: SW.-Kommando „Donau“
1.3 Polen: SW.-Kommando „Weichsel“
1.4 Niederlande: Die SW.-Kommandos „Niederlande“ und „IJsselmeer“
1.5 Baltikum: SW.-Kommando „Ostland“
1.6 Italien: Die SW.-Kommandos „West-Adria“ und „Ost-Adria“
1.7 Jugoslawien: SW.-Flottille „Serbien“
1.8 Weißrussland, Ukraine und die südliche Sowjetunion
1.9 Ungarn: SW.-Flottille „Ungarn“
1.10 Dänemark: SW.-Kommando „Dänemark“
1.11 Norwegen: SW.-Kommando „Norwegen“
1.12 „…an den Brennpunkten des Geschehens“: Die Marine-Küstenpolizei (M.K.P.)
1.13 Organisatorische und personelle Verflechtungen von Wasserschutzpolizei und Kriegsmarine
Teil 2 Kriegsverbrechen der Wasserschutzpolizei im auswärtigen Einsatz
2.1 „Partisanenbekämpfung“ und „Bandenkampf“ durch die deutsche Besatzungsmacht: Eine Einführung am Beispiel Weißrussland
2.2 Weißrussland: „Judenverfolgung“ und „Judenvernichtung“: Eine kurze Erläuterung
2.3 Erschießung von Zivilisten als „Sühnemaßnahmen“
Teil 3 Zwei tragische Schicksale
3.1 Verurteilung durch die DDR-Justiz
3.2 NS-Justiz: Todesurteil wegen „Zersetzung der Wehrkraft“
Nachwort