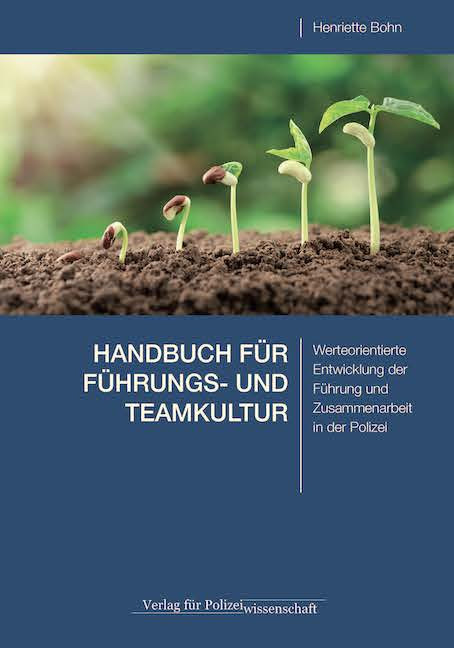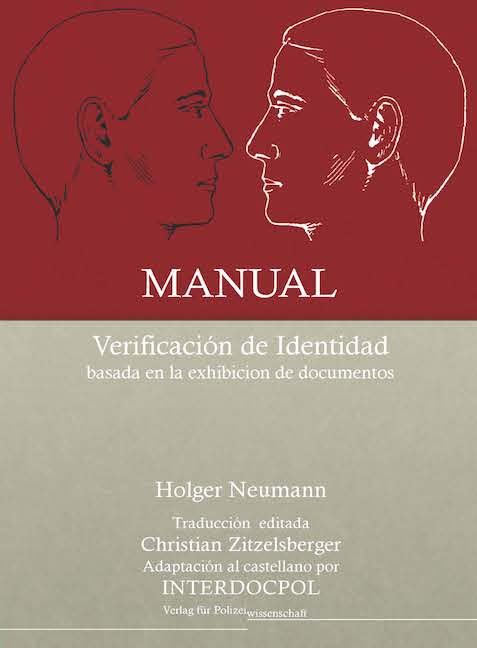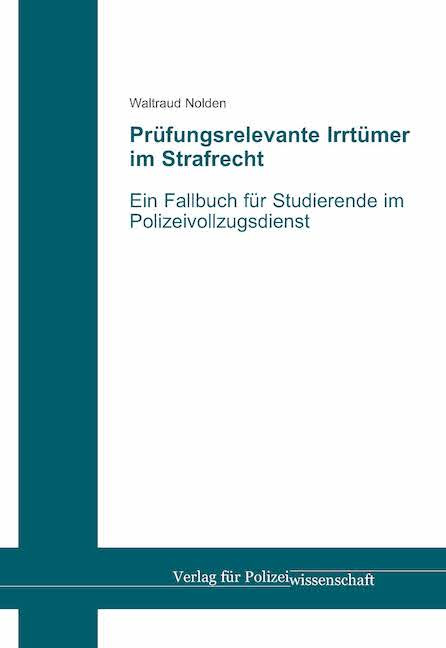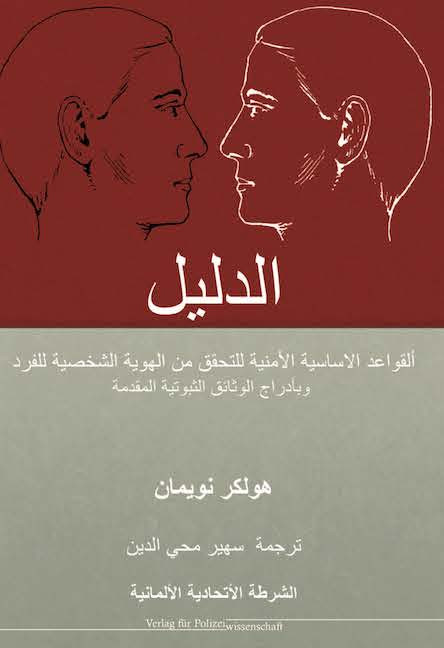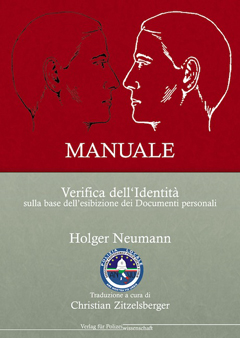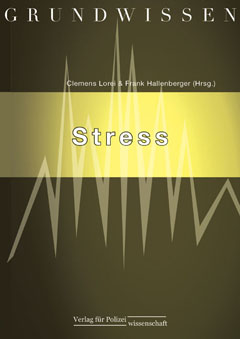
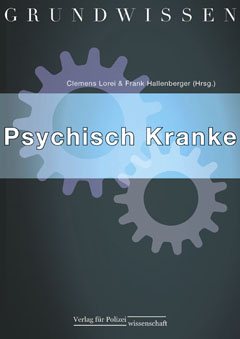
Henriette Bohn
HANDBUCH FÜR FÜHRUNGS- UND TEAMKULTUR Werteorientierte Entwicklung der Führung und Zusammenarbeit in der Polizei
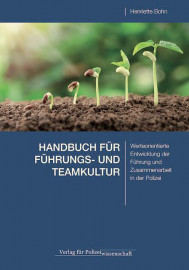
Mit zahlreichen farbigen Abbildungen
Werte stehen für etwas Wünschenswertes und richten auf höhere Prinzipien und Ideale aus. Die Orientierung auf bestimmte Werte entspricht also immer einem individuellem Wollen, das sich einem höheren Gut widmet. Der Vorteil in der Ausrichtung auf Werte in der Mitarbeiterführung ist, dass diese nachhaltig und situationsübergreifend wirken. Schwierig ist nur, dass Werte oft abstrakt sind und oft auf unbewusste Weise wirken. Führungskräften stellt sich somit die Frage, wie man diese abstrakten Orientierungsgrößen konkret nutzen und in konkrete Handlungen überführen kann. Dieses Handbuch bietet hierfür eine Sammlung an Methoden. Es beginnt mit Methoden zur Orientierung auf individuelle Werte und schafft damit Ansätze zu sehr spezifischer Wertschätzung von Mitarbeitern. Es bietet Methoden zur kollektiven Werteorientierung und damit einer Grundlage für Abstimmung, Zusammenarbeit und Konfliktprävention im Team. Methoden zur Orientierung auf organisationale Werte, welche die Identifikation der Mitarbeitenden mit ihrem Arbeitsbereich stärken sollen, bilden den Abschluss der Sammlung. Auch wenn die Methoden einzeln angewandt werden können, so ist das Besondere dieses Handbuchs, dass das Entwickeln von Werteorientierung – aus dem Individuellen ins Kollektive ans Organisationale heran – einem Prozess folgt. Dieser ist für eine verzahnende Durchführung über verschiedene Hierarchieebenen hinweg erläutert worden.
Inhalt
Inhalt:
Vorwort
Einführung
Überblick - Wie dieses Handbuch zu lesen ist
Hintergründe - Warum werteorientierte Kulturentwicklung?
Ziele - Wozu werteorientierte Kulturentwicklung?
Rahmenbedingungen - Wo findet werteorientierte Kulturentwicklung statt?
Durchführung - Wie findet werteorientierte Kulturentwicklung statt?
Ressourcen - Was braucht werteorientierte Kulturentwicklung?
Erfahrungen - Was passiert bei werteorientierter Kulturentwicklung?
Startphase - "Kurs 0" - Erwartungen an Führung
Inhalte der Startphase - Ausrichtung auf Werteorientierung
Verzahnung der Ebenen - Kurs 0?
Durchführung Kurs 0
Durchführung Kurs 0 - Rollenerwartungen
Durchführung Kurs 0 - Führung als Einflussnahme auf kulturellen Reifegrad
Erfahrungen Kurs 0
Teilnehmerfeedbacks zu Kurs 0
Trainererfahrungen zu Kurs 0
Kurs 1 - Individuelle Werteorientierung
Die Orientierung auf individuelle Werte
Inhalte Kurs 1
Werteorientierte Kulturentwicklung im Kurs 1
Verzahnung der Ebenen - Kurs 1?: Werteorientierung der Mitarbeitenden
Zuständigkeiten im Kurs 1
Durchführung Kurs 1 - Individuelle Werteorientierung
Durchführung Kurs 1a - Grundwerte und Grundhaltung
Durchführung Kurs 1b - Grundhaltung und Reifegrad
Durchführung Kurs 1c - Blockierungen und Blockaden
Anlage A1a: Individuelle Grundwerte
Anlage A1b: Reifegradstufen
Anlage A1c: Blockierungen und Blockaden
Erfahrungen im Kurs 1
Teilnehmerfeedbacks zu Kurs 1
Trainererfahrung im Kurs 1
Kurs 2 - Individuelle Werteentfaltung
Von individueller Werteorientierung zu individueller Werteentfaltung
Inhalte im Kurs 2
Werteorientierung im Kurs 2
Verzahnung der Ebenen - Kurs 2?: Werteentfaltung der Mitarbeitenden
Zuständigkeiten im Kurs 2
Durchführung Kurs 2 - Individuelle Werteentfaltung
Selbstbild-Fremdbild und Feedback
Durchführung Kurs 2b: Werte-Feedback
Anlage A2a: Individueller Wertebeitrag
Anlage A2b: Werte-Feedback
Erfahrungen Kurs 2
Teilnehmerfeedbacks zu Kurs 2
Trainererfahrungen zum Kurs 2
Kurs 3 - Kollektive Werteorientierung
Von individueller Werteentfaltung zu kollektiver Werteorientierung
Inhalte Kurs 3
Werteorientierte Kulturentwicklung in Kurs 3
Verzahnung der Ebenen - Kurs 3?: Werteorientierung der Gruppe
Zuständigkeiten für Kurs 3
Durchführung Kurs 3
Durchführung 3a: Werte im Team
Durchführung 3b: Werteorientierte Teamanalyse - Werte-Beiträge-Bedarfe
Durchführung 3c: Kollektives Leitbild
Anlage A3bc: WO-Teamanalyse + Kollektives Leitbild
Erfahrungen zu Kurs 3
Teilnehmerfeedbacks zu Kurs 3
Trainererfahrung im Kurs 3
Kurs 4 - Kollektive Werteentfaltung
Von kollektiver Werteorientierung zu kollektiver Werteentfaltung
Inhalte im Kurs 4
Werteorientierung im Kurs 4
Verzahnung der Ebenen - Kurs 4?: Werteentfaltung der Gruppe
Zuständigkeiten für Kurs 4
Durchführung Kurs 4: Werteorientierte Handlungsansätze
Zuteilung von Zuständigkeiten
Zuordnung der Maßnahmen zu Organisationswerten
Präsentation und Erstellen einer Maßnahmenliste
Rücksprache zu Maßnahmen und Zuständigkeiten mit MA in Kurs 4?
Erfahrungen zu Kurs 4
Teilnehmerfeedback zu Kurs 4
Trainererfahrung im Kurs 4
Werteorientierte Feedbacks - Werteforderung und Werteförderung
Wertschätzung als Werteforderung und Werteförderung
Werteorientiertes Feedback als Methode zur Kulturentwicklung
Verzahnung der Ebenen - Feedback von verschiedenen Hierarchieebenen
Zuständigkeiten bei den werteorientierten Feedbacks
Durchführung: Werteorientierte Feedbacks
Erfahrungen des Trainers
Konsolidierungsphase - Organisationale Werteorientierung
Kollektive Werteförderung durch organisationale Werteorientierung
Übergabe der Prozessgestaltung
Weiterführung in der Basis
Evaluation durch Interviews
Erfahrungen + Tipps des Trainers
Literaturverzeichnis
Holger Neumann / Traduzione a cura di Christian Zitzelsberge
MANUAL Verificación de identidad basada en la exhibición de documentos
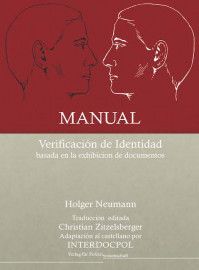
El material explica los conceptos básicos esenciales para la identificación personal y representa un método de educación bien estructurado para la verificación de identidad, poniendo a disposición la selección necesaria con respecto a las características externas de las personas que se utilizarán de manera específica y bien definida. Estas características se han recopilado en una terminología específica para ser utilizadas y están respaldadas por representaciones gráficas detalladas de Otto Haikenwälder.
Además, el manual trata los problemas inherentes a las evaluaciones dudosas de la identidad de las personas y del complejo de factores de perturbaciones técnicas y biológicas que pueden ocurrir en la comparación Imagen - Imagen.
El autor es empleado de la policía federal alemana y participó intensamente a principios de la década de 1980 en el tema de los controles de identidad de la policía basados en los documentos de identidad presentados. En 2004, por invitación del entonces Colegio Federal de Policía Fronteriza en Lübeck, presentó el tema de la verificación de identidad. En este sentido, por invitación, regularmente imparte conferencias en la Academia de la Policía Federal en Lübeck, así como a nivel regional para la capacitación y actualización del personal de la Policía Federal.
En 2009, Holger Neumann planea para la policía federal alemana, un modelo de capacitación de postgrado para la institución regional de los llamados especialistas para el control de identidad de la policía, tomando la posición docente en el curso piloto en 2011.
Inhalt
ÍNDICE:
1.0 Introducción
1.1 Información legal
2.0 Definición
2.1 Identidad
2.2 Características externas
2.3 Similitudes
3.0 Terminología
3.1 La cabeza
3.2 La triple repartición en la forma de la cabeza
3.3 La frente
3.4 Las cejas
3.5 Los ojos
3.6 La nariz
3.7 La boca
3.8 La barbilla o el mentón
3.9 El oído
3.10 La forma del pelo y el peinado.
3.11 Las arrugas y los surcos.
4.0 Las tres fases de la identificación visual hechas por la Policía (PIP)
4.1 La descripción y comparación de la persona.
4.2 La comparación fotográfica de la persona.
4.3 La toma de decisiones
4.4 Los factores perturbadores.
5.0 Análisis de las características
5.1 Actos para el análisis de las características
5.2 Métodos de verificación adicional
5.3 Facsímil impreso de
6.0 Descripción de la persona
6.1 Directrices para la descripción
7.0 Anexos de Bibliografía y fuentes de información
Waltraud Nolden
Prüfungsrelevante Irrtümer im Strafrecht Ein Fallbuch für Studierende im Polizeivollzugsdienst

Inhalt
Inhalt:
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Vereinfachtes Grobsystem zur generellen Behandlung von Irrtümern
1.1 Irrtümer zu Gunsten des Irrenden
1.1.1 Tatumstandsirrtum nach § 16
1.1.2 Verbotsirrtum nach § 17
1.2 Irrtümer zu Ungunsten des Irrenden
1.2.1 Umgekehrter Tatumstandsirrtum
1.2.2 Wahndelikt
1.3 Zusammenfassendes Grobgerüst
1.4 Fälle
2 Detaildarstellung der Irrtümer zu Gunsten des Irrenden
2.1 Error in persona vel obiecto und aberratio ictus
2.1.1 Überblick
2.1.2 Aufbau
2.2 Irrtum über den Kausalverlauf
2.2.1 Überblick
2.2.2 Aufbau
2.3 Unkenntnis einer Garantenstellung oder Garantenpflicht
2.3.1 Überblick
2.3.2 Aufbau
2.4 Subsumtionsirrtum
2.4.1 Überblick
2.4.2 Aufbau
2.5 Unkenntnis einer mittelbaren Täterschaft
2.5.1 Überblick
2.5.2 Aufbau
2.6 Unkenntnis einer objektiven Strafbarkeitsbedingung
2.6.1 Überblick
2.6.2 Aufbau
2.7 Irrige Annahme von Rechtfertigungsgründen
2.7.1 Überblick
2.7.2 Aufbau
2.8 Direkter Verbotsirrtum
2.8.1 Überblick
2.8.2 Aufbau
2.9 Irrige Annahme von Entschuldigungsgründen
2.9.1 Überblick
2.9.2 Aufbau
3 Detaildarstellung der Irrtümer zu Ungunsten des Irrenden
3.1 Untauglicher Versuch oder Wahndelikt
3.1.1 Überblick
3.1.2 Aufbau
3.2 Grob unverständiger und irrealer/abergläubischer Versuch
3.2.1 Überblick
3.2.2 Aufbau
3.3 Irrige Annahme einer Garantenstellung oder Garantenpflicht
3.3.1 Überblick
3.3.2 Aufbau
3.4 Irrige Annahme einer mittelbaren Täterschaft
3.4.1 Überblick
3.4.2 Aufbau
3.5 Irrige Annahme einer objektiven Strafbarkeitsbedingung
3.5.1 Überblick
3.5.2 Aufbau
3.6 Umgekehrter Erlaubnistatbestandsirrtum (Fehlen des subjektiven Rechtfertigungselements)
3.6.1 Überblick
3.6.2 Aufbau
3.7 Unkenntnis eines Entschuldigungsgrundes
3.7.1 Überblick
3.7.2 Aufbau
4 Fallbeispiele im Überblick
4.1 Irrtümer zu Gunsten des Irrenden
4.1.1 Error in persona vel obiecto, aberratio ictus (Fälle (1) – (8))
4.1.2 Irrtum über den Kausalverlauf (Fälle (9) – (10))
4.1.3 Unkenntnis von Garantenstellung oder Garantenpflicht (Fälle (11) – (12))
4.1.4 Subsumtionsirrtum (Fälle (13) – (15))
4.1.5 Unkenntnis einer mittelbaren Täterschaft (Fälle (16) - (18))
4.1.6 Unkenntnis einer objektiven Strafbarkeitsbedingung (Fälle (19) – (20))
4.1.7 Irrige Annahme von Rechtfertigungsgründen (Fälle (21) - (24))
4.1.8 Direkter Verbotsirrtum (Fall (25))
4.1.9 Irrige Annahme von Entschuldigungsgründen (Fälle (26) - (27))
4.2 Irrtümer zu Ungunsten des Irrenden
4.2.1 Untauglicher Versuch (Fälle (28) - (30))
Wahndelikt (Fälle (31) - (33))
Irrtum im Vorfeld des Tatbestandes (Fall (34))
4.2.2 Grob unverständiger und irrealer/abergläubischer Versuch (Fälle (35) – (36))
4.2.3 Irrige Annahme einer Garantenstellung oder Garantenpflicht (Fälle (37) – (38))
4.2.4 Irrige Annahme einer mittelbaren Täterschaft (Fälle (39) – (41))
4.2.5 Irrige Annahme einer objektiven Bedingung der Strafbarkeit (Fälle (42) - (43))
4.2.6 Umgekehrter Erlaubnistatbestandsirrtum (Fehlen des subjektiven Rechtfertigungselements) (Fall (44))
4.2.7 Unkenntnis eines Entschuldigungsgrundes (Fälle (45) – (46))
5. Prüfungsrelevante Irrtümer im Überblick
6. Literaturverzeichnis
7. Stichwortverzeichnis
Holger Neumann
Handbuch Polizeiliche Identitätsprüfung auf der Basis vorgelegter Personaldokumente Arabisch

Das Material erläutert wesentliche Grundlagenbegriffe der polizeilichen Personenidentifizierung, präsentiert eine strukturierte Anleitung zur Durchführung der Identitätsprüfung und stellt die notwendige Auswahl von klar definierten Merkmalen des Äußeren von Personen zur Verfügung. Diese Merkmale werden in einer einheitlichen Terminologie zusammengefasst und sind durch erklärende Grafiken von Otto Haikenwälder unterlegt.
Weiterhin wird die Abarbeitung von Zweifeln an der Identität von Personen und der Komplex möglicher technischer und biologischer Störfaktoren beim Bild – Bild Vergleich behandelt.
Inhalt
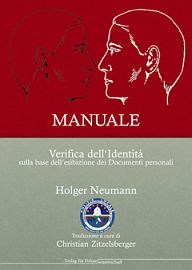
Il presente Manuale - Verifica dell‘Identità è indirizzato soprattutto agli operatori di Polizia, di Giustiza e Frontaliero, ma si rivolge anche agli addetti dei servizi di sicurezza privati, che devono identificare persone sulla base di Documenti d‘identificazione mostrati.
Il materiale spiega i concetti di base essenziali per la identificazione personale, e rappresenta un metodo d‘istruzione ben strutturato per la Verifica dell‘Identità mettendo a disposizione la necessaria selezione riguardante le Caratteristiche Esteriori delle persone da utilizzare in maniera specifica e ben definita. Tali caratteristiche sono state raccolte in una specifica Terminologia da utilizzare e sono supportate da dettagliate rappresentazioni grafiche di Otto Haikenwälder. Inoltre il manuale tratta le problematiche inerenti a valutazioni dubbiose dell‘identità delle persone e del complesso di fattori di disturbo tecnici e biologici che possono avvenire nella comparazione Immagine - Immagine.
Inhalt
INDICE
1.0 Premessa
1.1 Informazione giuridica
2.0 Definizione
2.1 Identità
2.2 Caratteristiche esterne
2.3 Similitudini
3.0 Terminologia
3.1 La Testa
3.2 La tripla ripartizione/Forma della testa
3.3 La Fronte
3.4 Le Sopracciglia
3.5 Gli Occhi
3.6 Il Naso
3.7 La Bocca
3.8 Il Mento
3.9. L’orecchio
3.10 L’attaccatura dei Capelli
3.11 Rughe e solchi
4.0 Le tre fasi della Identificazione visiva di Polizia (PIP)
4.1 Comparazione Descrizione – Persona
4.2 Comparazione Fotografia – Persona
4.3 Il Processo decisionale
4.4 Fattori di disturbo
5.0 L’analisi delle Caratteristiche 5.1 Atti per l’analisi delle Caratteristiche
5.2. Ulteriori Metodi di verifica
5.3 Stampato Fac-simile
6.0 Descrizione della Persona
6.1 Indicazioni per la descrizione
7.0 Allegati
Letteratura e informazioni d’origine
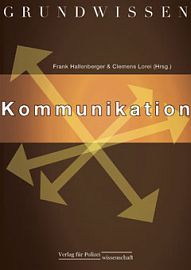
Inhalt
Inhalt:
Kommunikationstheorien
nonverbale Kommunikation
Geschlechtsspezifische Kommunikation
NLP
aktives Zuhören
Fragen
Ich-Botschaften
Feedback
Umgang mit Opfer
überbringen von Todesnachrichten
psychische erste Hilfe
Deeskalation
Vernehmung und Befragung Umgang mit Provokationen
Kommunikation mit Suizidgefährdeten
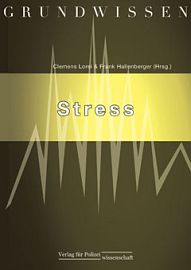
Inhalt
Inhalt:
Polizei & Stress
Stresstheorien
Stressreaktionen
Stress & Gesundheit
Stress & Leistung
Stressbewältigung
Hochstress & Trauma
Work-Life-Balance
Burn-Out
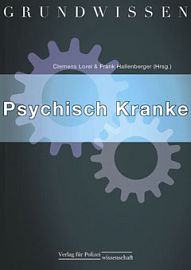
Inhalt
Polizei & psychisch Kranke
Gefährlichkeit psychisch Kranker Umgang mit psychisch Kranken
Schuldfähigkeit
Ursachen psychischer Störungen
Therapieformen
Angststörungen Persönlichkeitsstörungen
Affektive Störungen
Schizophrenie Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
Interaktions- und Familienprobleme
Suizidgefahr Störungen im Alter
Störungen in Kindheit und Jugend