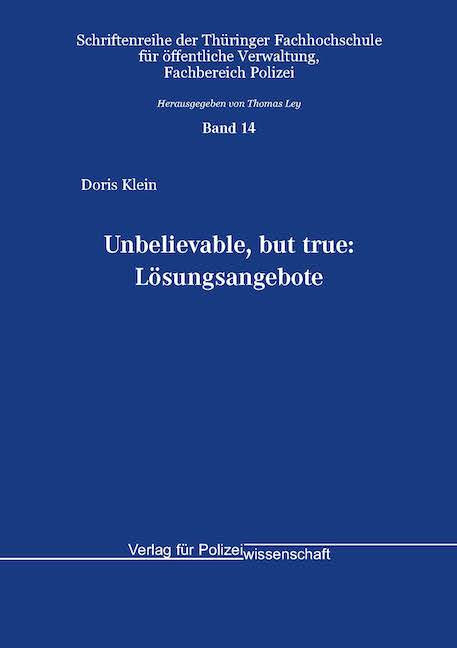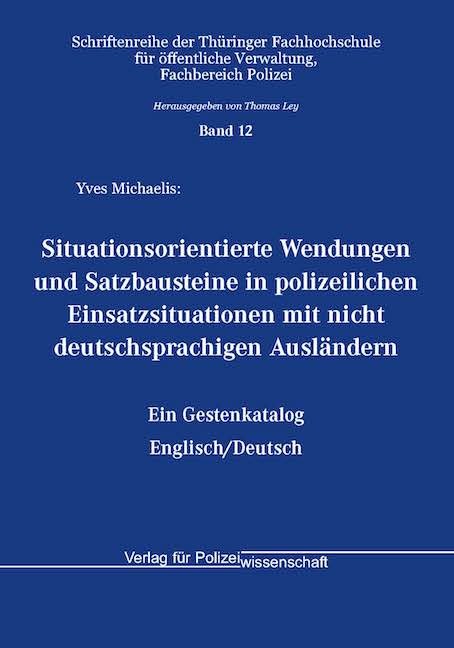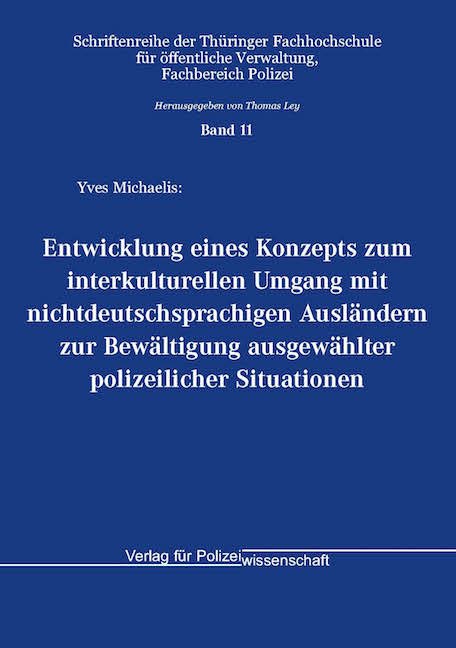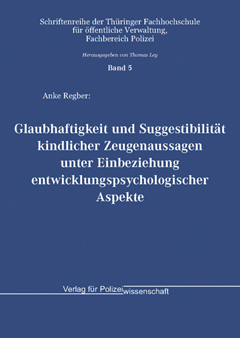Die rechtliche Würdigung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im polizeilichen Alltag ist oft alles andere als einfach. Dies gilt erst recht dann, wenn rechtliche Würdigungen in einer fremden Sprache erfolgen müssen.
Die Lösungshinweise in diesem Band bieten dem Benutzer die Möglichkeit, die englische (Polizei-) Fachsprache zu lernen bzw. zu vertiefen und polizeiliche Sachverhalte interdisziplinär zu bearbeiten.
Da sich das Recht als normative Grundlage polizeilichen Handelns durch die aktuelle Rechtsprechung oder Rechtsänderungen in einem kontinuierlichen Wandel befindet, sind die fachlichen Lösungshinweise unter diesem Vorbehalt zu lesen.
Inhalt
Inhalt:
Preface
Case No. 1 Received and lost at the same time
Case No. 2 Snow and disappointment
Case No. 3 At knife point
Case No. 4 A fugitive offender
Case No. 5 Cyberspace Crime
Case No. 6 A successful day
Case No. 7 A shooting incident
Case No. 8 Drunk Skinheads
Case No. 9 HGV (Heavy Goods Vehicle)
Case No. 10 Friday the 13th of all days or the dead offender
Case No. 11 Happy Ending
Case No. 12 A bit different
Attachment
Yves Michaelis
Situationsorientierte Wendungen und Satzbausteine in polizeilichen Einsatzsituationen mit nicht deutschsprachigen Ausländern Ein Gestenkatalog (Englisch/Deutsch)
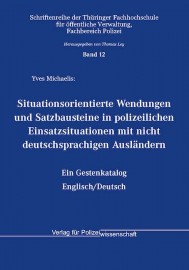
Gestik und Mimik sind bei der Verständigung mit nicht deutschsprachigen Ausländern von sehr großer Bedeutung. Gesten in unterschiedlichen Kulturkreisen können unterschiedliche Signale aussenden. Sie richtig zu dekodieren ist in polizeilichen Alltagssituationen enorm wichtig. Nicht zuletzt kann die Benutzung der richtigen Gestik und Mimik zusätzlich zur verbalen Kommunikation zur Deeskalation im polizeilichen Alltag beitragen. Der Gestenkatalog soll hierzu eine Hilfestellung bieten.
Inhalt
Inhalt
I. GESTEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER VERBALEN KOMMUNIKATION
II. SITUATIONSORIENTIERTE WENDUNGEN UND SATZBAUSTEINE
1. ANHALTEN, ANSPRECHEN UND VORSTELLEN
2. ALLGEMEINE FORMULIERUNGEN ZUR VERSTÄNDIGUNG
3. ALLGEMEINE FORMULIERUNGEN ZUR BERUHIGUNG, DEESKALATION, EINFRIERUNG DER LAGE UND EIGENSICHERUNG
4. ALLGEMEINE NENNUNG DES GRUNDES
5. BELEHRUNGEN
6. PERSONALIENFESTSTELLUNG, FESTSTELLUNG VON BERECHTIGUNGEN
7. KLÄRUNG VON SACHVERHALTEN
8. PLATZVERWEIS, RÜCKKEHRVERBOT, WOHNUNGSVERWEISUNG
9. DURCHSUCHUNG, FESSELUNG
10. MITNAHME ZUR DIENSTSTELLE, GEWAHRSAM, VORLÄUFIGE FESTNAHME
11. SICHERSTELLUNG, BESCHLAGNAHME
12. FORMULIERUNGEN ZUM ÜBERZEUGEN
13. FORMULIERUNGEN ZUM WARNEN
14. FORMULIERUNGEN ZUM ANDROHEN VON FOLGEN UND MAßNAHMEN
III. BELEIDIGENDE UND MISSVERSTÄNDLICHE GESTEN
Yves Michaelis
Entwicklung eines Konzepts zum interkulturellen Umgang mit nichtdeutschsprachigen Ausländern zur Bewältigung ausgewählter polizeilicher Situationen
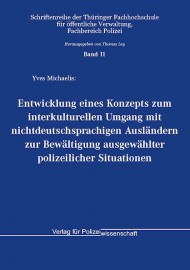
Inhalt
Inhalt
VORWORT VON DORIS KLEIN
1. PROBLEMSTELLUNG
2. THEORETISCHE ASPEKTE ZUM INTERKULTURELLEN UMGANG
2.1 KULTURBEGRIFF
2.2 INTERKULTURELLE KOMPETENZ
2.2.1 Einordnung interkultureller Kompetenz
2.2.2 Das Modell nach Bolten
2.2.3 Interkulturelle Kompetenz als polizeiliches Thema
2.3 INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION IM RAHMEN DER POLIZEIARBEIT
2.3.1 Das Sender-Empfänger-Modell
2.3.2 Die pragmatischen Axiome von Watzlawick
2.3.3 Problemfelder interkultureller Kommunikation
2.3.4 Die Kommunikationsebenen
2.3.5 Umgang mit Kommunikationsstörungen
2.3.6 Die Besonderheiten polizeilicher Kommunikation
2.4 ZUSAMMENFASSUNG
3. METHODIK
3.1 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR EIN POLIZEILICHES KONZEPT
3.2 LEITFADENGESTÜTZTE INTERVIEWS
3.2.1 Zielstellung und Beschreibung der Methode
3.2.2. Auswahl der Experten
3.2.3 Ablauf und Inhalt der Interviews
3.2.4 Durchführung der Interviews
3.2.5 Auswertung der Interviews
4. KONZEPT ZUM INTERKULTURELLEN UMGANG MIT NICHTDEUTSCHSPRACHIGEN AUSLÄNDERN
4.1 VERBALES UND NONVERBALES GRUNDVERHALTEN
4.2 ANWENDUNG VON KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN
4.3 EINSATZ DER ENGLISCHEN SPRACHE
4.4 EINSATZ VON UNTERSTÜTZENDER GESTIK
5. DISKUSSION
6. FAZIT
LITERATUR
ANHANG
A 1. ABBILDUNGEN UND TEXTAUSSCHNITT
A 2. BEFRAGUNG
A 2.1 Interviewleitfaden
A 2.2 Anmerkungen zu den Transkriptionen
A 3. KATALOGE
A 3.1 Anmerkungen zu den Katalogen
A 3.2 Situationsorientierte Wendungen und Satzbausteine
Anke Regber
Glaubhaftigkeit und Suggestibilität kindlicher Zeugenaussagen unter Einbeziehung entwicklungspsychologischer Aspekte
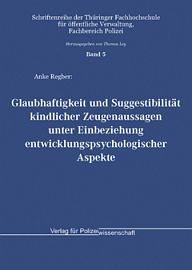
Spätestens seit den Wormser Missbrauchsprozessen
in den Neunziger Jahren weiß man um die Bedeutung kindlicher Zeugenaussagen.
Damals hatten fehlerhafte Glaubhaftigkeitsgutachten dazu geführt, dass
24 mutmaßlich des sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagte Männer
und Frauen letztendlich doch freigesprochen wurden. „Die familienübergreifenden
Massenmissbrauchshandlungen fanden nicht statt“, hatte der Vorsitzende
Richter im Urteil klargestellt und kam zum Ergebnis, dass die Kinder Opfer
derer wurden, die es gut gemeint und schlecht gemacht haben. Gemeint sind
Sachverständige, Kinderärzte, Psychologen, Staatsanwälte und
Ermittlungsrichter, die mit Ihren Untersuchungen und Vernehmungen vermeintliche
Straftaten entdeckten, die de facto nie geschehen waren. Ein Gutachten zeigte
damals auf, dass die Aussagen der Kinder durch die vielen Befragungen unbewusst
manipuliert worden waren.
Gerade bei Straftaten nach §§ 176, 176a, 176b StGB ist die Stimmung
im Umfeld von Ermittlungen aufgeheizt und eine sachlich-nüchterne Aufklärung
dieser Straftaten nicht immer einfach. Charakteristisch ist dabei die Intimität
der Tatsituation: Kinder sind bei derartigen Straftaten die einzigen Zeugen.
Allein von ihrer Aussage und der der Angeklagten hängt ein ent-sprechendes
Urteil ab. „Von den ersten Vernehmungen hängt also geradezu die
ganze Zukunft des Prozesses ab: In ihnen wird eigentlich fast immer der Sachverhalt
endgültig geklärt oder endgültig verschleiert“. Diese
Aussage von William Stern in seinem Werk „Jugendliche Zeugen in Sittlichkeitsprozessen,
ihre Behandlung und psychologische Begutachtung“ (1926, S. 47) bringt
zum Ausdruck, dass in frühen Phasen der Ermittlungsarbeit die Weichen
für den Erfolg oder Misserfolg eines Verfahrens gestellt wer-den. Denn
gerade hier – das haben die Erfahrungen der Wormser Miss-brauchsprozesse
gezeigt – ist die Gefahr der Beeinflussung der Kinder durch suggestives
Befragen am größten.
Entscheidend bleibt die Frage, ob ein Kind nun die Wahrheit sagt oder nicht.
Anke Regber gibt in ihrer Arbeit zahlreiche Hinweise zur Glaubhaf-tigkeitsbeurteilung
von kindlichen Zeugenaussagen hinsichtlich entwicklungspsychologischer Aspekte.
Auch die Ausführungen der Autorin zum Problem der Suggestibilität
von Kindern machen die vorliegende Arbeit zu einem wertvollen Begleitbuch
für die polizeiliche Praxis. Es eignet sich dabei trotz des expliziten
Bezugs auf kindliche Zeugenaussagen desgleichen für Praktiker, die vornehmlich
mit Vernehmungen von Erwachsenen zu tun haben.
Mit der Lektüre dieser Arbeit verbindet die Autorin die Hoffnung, dass
die Integrierung entwicklungspsychologischer Aspekte in die polizeiliche Vernehmungslehre
dazu führen könnte, dass der Beamte mehr Verständnis für
die Eigenart des kindlichen Denkens, Handelns und Erlebens entwickelt. Letztendlich
geht es darum, das vom Kind Erlebte möglichst wirklichkeitsgetreu zu
erfassen. Denn der Fall Worms zeigt: selbst bei Freispruch sind die Angeklagten
für den Rest ihres Lebens stigmatisiert. Und die Leidtra-genden sind
am Ende doch die Kinder.
Inhalt
Inhalt:
1. Einleitung
2. Geschichtliche Aspekte
2.1 Zeugeneignung von Kindern im Wandel der Zeit
2.2 Geschichte der gerichtlichen Sachverständigentätigkeit
3. Die psychologische Begutachtung
3.1 Der psychologische Sachverstand als Beweismittel (Möglichkeiten und
Grenzen)
3.2 Anlass und Häufigkeit der Begutachtung von Kindern
3.3 Der Stellenwert der Begutachtung
3.4 Ein überblick zu den aussagepsychologischen Konstrukten
4. Zeugeneignung von Kindern aus entwicklungspsychologischer
Sicht
4.1 Aussage- bzw. Zeugentüchtigkeit
4.2 Kinder verschiedener Alterstufen als Zeugen
5. Die Glaubhaftigkeit einer Aussage
5.1 Differenzierung zwischen Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit
5.2 Bedeutung für Praxis
5.3 Differenzierung zwischen Glaubhaftigkeit und Aussagegenauigkeit
5.4 Unterschiede zwischen erlebnisbegründeten und unwahren Aussagen
5.5 Motivbezogene Aspekte beim Kind
5.6 Hinweise für die polizeiliche Praxis
6. Das Problem der Suggestibilität
6.1 Begriffsbestimmung
6.2 Das Werk von William Stern
6.3 Allgemeine Ausführungen zum Suggestionsprozess
6.4 Bedingungen für das Auftreten von Suggestionseffekten
6.5 Differenzierung zwischen wahren und suggerierten Aussagen
6.6 Suggestibilität und Alter des Kindes
6.7 Einfluss von Zeitpunkt und Häufigkeit der Präsentation falscher
Informationen
6.8 Hinweise für die polizeiliche Praxis