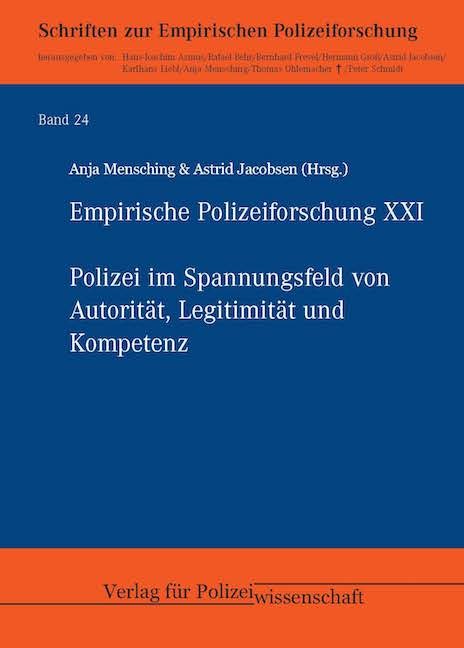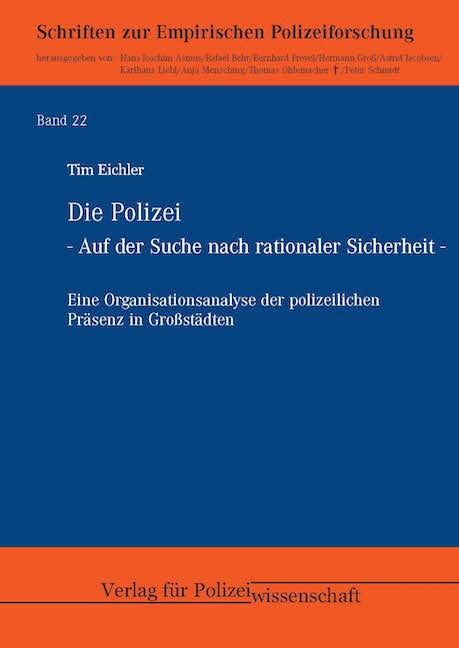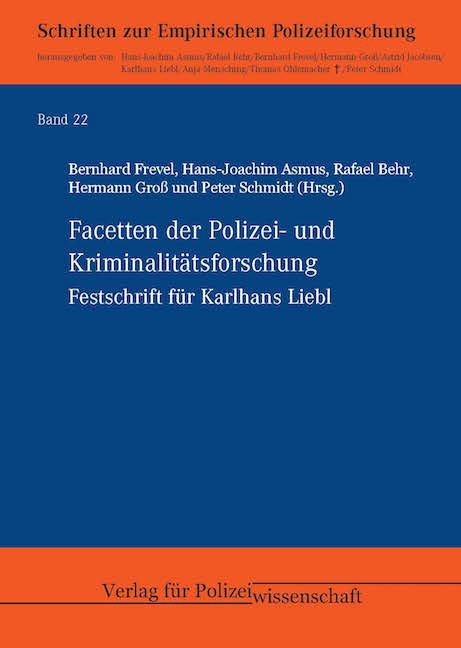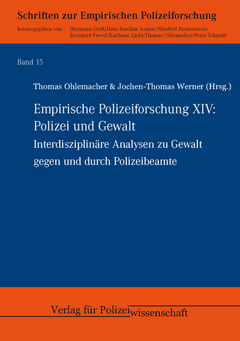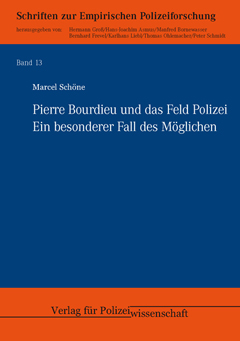Anja Mensching & Astrid Jacobsen (Hrsg.)
Empirische Polizeiforschung XXI Polizei im Spannungsfeld von Autorität, Legitimität und Kompetenz
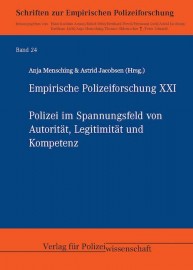
Die Jahrestagung der Empirischen Polizeiforschung 2017 widmete sich dem Spannungsfeld von Autorität, Legitimität und Kompetenz unter der Prämisse, dass polizeiliche Autorität dabei nicht – wie im gesellschaftlichen und polizeilichen Alltagverständnis üblich – als Voraussetzung polizeilichen Handelns betrachtet wird, das der Polizei ‚naturgemäß‘ zusteht und zum Teil missachtet wird. Stattdessen soll der Blick auf polizeiliche Autorität als Produkt eines komplexen Herstellungsprozesses mit Bezügen zu polizeilichen Legitimitäts- und Kompetenzfragen gerichtet werden.
Dieser Tagungsband zur Jahrestagung der Empirischen Polizeiforschung XXI versammelt neben den Vortragsbeiträgen auch die verschriftlichten Versionen der Posterpräsentationen, die Nachwuchswissenschaftler/innen auf der Tagung vor- und zur Diskussion stellten. Der vorliegende Band gliedert sich in die vier thematische Abschnitte:
I. Polizei als sich selbst beobachtende bzw. Autorität und Legitimität herstellende Organisation
II. Polizei als Kompetenz, Legitimität und Autorität im Außenverhältnis herstellende Organisation
III. Polizei als beobachtende, kontrollierende und Autorität und Legitimität herstellende Organisation
IV. Polizei als Konfliktpartner, Gewaltmonopolist und medial inszenierte Organisation
Inhalt
Inhalt:
Editorial: Polizei im Spannungsfeld von Autorität, Legitimität und Kompetenz
Anja Mensching & Astrid Jacobsen
Kapazitäten und Ansprüche polizeilicher Kriminalprävention.
Ein Plädoyer für die mitlaufende Bearbeitung prekärer Autorität und Legitimation.
Thomas Scheffer
Legitimität und Authentizität – Wertschätzung als organisationskultureller Aspekt des ‚Doing Authority‘ in der Polizei
Marlene Tietz & Anja Mensching
„Wir sind die Polizei. Das Schlusswort haben wir.“ (Un)doing authority in einem Schweizer Polizeidienst
Nathalie Pasche, Esteban Piñeiro & Martina Koch
Polizei als Status. Polizeipolitik als Statuspolitik?
Susanna Ehrensberger, Annelie Molapisi & Rainer Prätorius
Nachwuchsforschungsprojekt PluS-i: Interdisziplinäre Analysen für ein kontextadäquates, legitimes, effizientes und effektives plurales Polizieren im urbanen Raum
Nathalie Hirschmann & Tobias John
Neue Wege zur Darstellung der Rolle der Polizei
Christian Hamm & Markus Sander
Zur Legitimation polizeilicher Kontrolle. „Racial-“, „Social-“ und „Criminal-Profiling“ im Diskurs
Rafael Behr
Subtile Autorität und prekäre Legitimität der Videoüberwachung von Demonstrationen – Praxen und Wissensformen von Polizei und Protestierenden
Peter Ullrich
Im Namen der Gerechtigkeit? Über die Rechtfertigungsmuster polizeilicher Kompetenzüberschreitungen
Elena Isabel Zum-Bruch
Polizei und Staatsbildung in Venezuelas Bolivarischer Revolution: Polizeibefugnisse und ordnungspolitische Kontrolle in einem Hybridregime
Stiven Tremaria
„Ich hab’ Polizei“ – Die Darstellung der Polizei in deutschsprachigen Rapliedern
Christian Wickert
Tim Eichler
Die Polizei - Auf der Suche nach rationaler Sicherheit - Eine Organisationsanalyse der polizeilichen Präsenz in Großstädten

Die Studie stellt die Frage, ob Steuerungskonzepte für die Polizei passend sind, wie die Organisation mitunter eher kreativ damit umgeht und welche Effekte erzielt werden können. Auf der Grundlage von vergleichenden Fallstudien zu polizeilichen Präsenzkonzepten in fünf nordrhein-westfälischen Polizeibehörden arbeitet sie unter Nutzung des Konzepts des organisational-motiverten Handelns diverse Defekte der polizeilichen Verwaltungsmodernisierung heraus und hinterfragt, ob die Vorstellung der rationalen Steuerung nicht eher ein Mythos sei. Es wird dargestellt, wie die sozialkonstruktivistische Vorstellung von Sicherheit mit einer überkomplexen gesellschaftlichen Wertung und eine aus der polizeipraktisch gedeuteten und unterkomplexen Vorstellung von Sicherheitsproduktion konflikthaft aufeinanderprallen. Die Studie liefert einen wichtigen Beitrag für die verwaltungswissenschaftliche Analyse der Polizeiarbeit und deren Steuerung.
Inhalt
Inhalt
1.1 Problemstellung
Bernhard Frevel, Hans-Joachim Asmus, Rafael Behr, Hermann Groß und Peter Schmidt (Hrsg.)
Facetten der Polizei- und Kriminalitätsforschung Festschrift für Karlhans Liebl

Inhalt
Inhalt:
Das „Ehritorial“
Kriminologische Fragen
Die „klassischen“ Anomietheorien und ihr Beitrag zur Erklärung von Jugendkriminalität
Hans-Joachim Asmus
Empirische Forschung zur subjektiven Sicherheit in einer Grenzregion
Anton Sterbling
Gefährlichkeit als soziales Konstrukt
Klaus Neidhardt
Polizei und Polizieren
„Wir ermitteln in alle Richtungen“ – Polizeiliche Verdachtsschöpfung zwischen Bauchgefühl, Diskriminierung und hierarchisches Wissensproduktion
Rafael Behr
Fehlerkultur und Polizei
Michael Jasch
Freiwilliger Polizeidienst in Hessen als Gegenstand empirischer Polizeiforschung
Hans Schneider
Ohne Polizei keine Sicherheit? Bürgerwehren – oder: Der Kampf ums Monopol
Marschel Schöne
Leitbilder in der Polizei: Wichtiges Instrument strategischen Managements oder nur symbolische Politik? – Ein Plädoyer für die Revitalisierung des Leitbilder der hessischen Polizei
Hermann Groß & Peter Schmidt
Bildungsarbeit in und für die Polizei
Polizei, Politik und Bildung
Bernhard Frevel & Philipp Kuschewski
Man müsste Klavierspielen können... – Der ungehobene Datenschatz der polizeilichen Vorgangsbearbeitung
Eberhard Kühne
Polizeiforschung und Polizeiwissenschaft
Polizeiwissenschaft als Verwaltungswissenschaft – zur Entwicklung der Deutschen Hochschule der Polizei
Hans-Jürgen Lange & Michaela Wendekamm
Der Wandel der Polizei – im Spiegel des Arbeitskreises Empirische Polizeiforschung?
Lena Lehmann
Polizisten: schlau... Professoren: doof
Rainer Prätorius
Über und von Karlhans Liebl
Lebenslauf
Schriftenverzeichnis
Thomas Ohlemacher & Jochen-Thomas Werner (Hrsg.)
Empirische Polizeiforschung XIV: Polizei und Gewalt Interdisziplinäre Analysen zu Gewalt gegen und durch Polizeibeamte
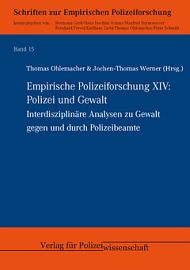
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
Polizei und Gewalt
Für einen sachlichen Diskurs statt reflexartiger Reaktionen
Zur Einleitung dieses Bandes
Thomas Ohlemacher und Jochen-Thomas Werner
Gewalt gegen Polizeibeamte: Chancen und Grenzen der wissenschaftlichen Beobachtung von Handlungen und Folgen
Welche Einsätze sind für Polizeibeamte besonders gefährlich?
Dirk Baier und Karoline Ellrich
Gravierende Gewalt gegen Polizei im Hellfeld von Polizei und Justiz in Niedersachsen
Stefan Prasse und Hartmut Pfeiffer
Der "wahre Alltag" im Gewaltmonopol: Erste Ergebnisse verschiedener quantitativ-empirischer Studien zur Cop-Culture der Kölner Polizisten
Carsten Dübbers
Punitivität bei Polizeibeamten
Ein Vergleich mit der Allgemeinbevölkerung
Karoline Ellrich
Gewalt durch Polizeibeamte: Innerpolizeiliche Legitimationen und kriminalpolitische Diskurse
Polizeiliche Zwangsanwendungen gegenüber Jugendlichen Innen- und Außenperspektiven
Daniela Hunold
Das sogenannte Jagdfieber als Erklärungsansatz für Polizeigewalt
Clemens Lorei
Polizeikennzeichnung
Konfliktlinien und Akteurskoalitionen in einer jahrzehntelangen Debatte Hartmut Aden
Das Paradox des Gewaltmonopols in der Selbstdarstellung von Polizisten
Maja Apelt und Andreas Häberle
Die "Gewalt der Anderen" oder: Warum es bei der aktuellen Gewaltdebatte nicht (nur) um Gewalt geht
Rafael Behr
Polizei und öffentlichkeit: Aktuelle polizeiliche Selbstdarstellung
Gewalt in der polizeilichen öffentlichkeitsarbeit
Andreas Pudlat
Hinweise zu den Autorinnen und Autoren
Marcel Schöne
Pierre Bourdieu und das Feld Polizei - Ein besonderer Fall des Möglichen Schriften zur Empirischen Polizeiforschung, Band 13

Inhalt
Inhaltsverzeichnis
1. Prolog - Das Feld Polizei. Eine Außenansicht der Innenansicht
1.1 Modus Operandi – Methodisches
1.2 Forschungsthese
1.3 Das Feld Polizei
1.4 Positionen und Positionierungen
1.5 Wegskizze
2. Das Verhältnis von Nähe und Distanz zum Forschungsfeld oder die Grenzen objektivistischer Objektivierung
2.1 (Berufs)Biographisches
2.2 Grenzgänge
2.3 Fährnisse objektivistischer Objektivierung
2.4 Dosis facit venenum - Nähe und Distanz zum Forschungsfeld
2.5 Die Umkehrung des Verhältnisses zum Forschungsobjekt
2.6 Verbindung von Theorie und Praxis
3. Gesellschaftliche Differenzierung bei Pierre Bourdieu
3.1 Theorie der Praxis
3.2 Das Habituskonzept
3.3 Dialektik von Habitus und Feld
3.4 Das Feldkonzept
3.5 Das Kapitalkonzept Bourdieus
3.6 Conclusio
4. Die relative Autonomie der Felder
4.1 Cuius regio eius religio - Die Autonomie des Feldes Polizei
4.2 Polizei und Gesetze
4.3 Polizei und Politik
4.4 Polizei und Innenministerium
4.5 Polizei und Parlament
4.6 Polizei und Staatsanwaltschaft
4.7 Polizei und Medien
4.8 Polizei und Bürgerschaft
4.9. Conclusio
5. Kapitalien im Feld Polizei
5.1 Staatliches Metakapital – Schwungmasse des Feldes
5.2 Im Namen des Volkes oder Gewaltmonopol als symbolisches Kapital
5.3 Die Symbolik der Macht oder Das Ausstattungskapital der Polizei
5.4 Hexis des Feldes – Physisches Kapital
5.5 Polizeiliche (Aus)Bildung als kulturelles Kapital
5.6 Das Lachen der Polizeipräsidenten – Zur polizeilichen ökonomie
5.7 Nur für den Dienstgebrauch! - Kollegialer Gabentausch
5.8 Kurze Dienstwege - Sozialkapital im Feld
5.9 Nomen est omen - Ehrenkodex als symbolisches und soziales Kapital
5.10 Conclusio - Inflationsgeschütztes im Feld
6. Ruhe bewahren, Sicherheit ausstrahlen! – Das Produktionsfeld Polizei
6.1 Credo, ergo sum – Der Glaube an das polizeiliche Feld
6.2 Dr. Jekyll und Mr. Hyde? - Das polizeiliche Sein
6.3 Exkurs: Moderne und Sicherheit - So viel Freiheit wie möglich und so viel Sicherheit wie nötig?
6.4 Exklusive Sicherheitsproduktion – Der Kampf ums Monopol
6.5 Exkurs: Leviathan oder Behemoth - Die Grundstruktur der modernen Gesellschaft
6.6 Mundus vult decipi, ergo decipiatur – Die Präventivwirkung des Nichtswissens
7. Das Ausbildungssystem des Feldes Polizei
7.1 Zertifiziertes kulturelles Kapital
7.2 Polizeiliche Laufbahnen und Ausbildungseinrichtungen
7.3 Generalisten vs. Spezialisten
7.4 Interne Ausbildungswelt Polizei
7.5 Formelles und informelles Betriebswissen
7.6 Polizei und Polizistenkultur
7.7 Investitionen ins Feld
8. Raum des Möglichen – Das Feld als Denk- und Diskursraum
8.1 Die Macht der Zeichen – Zum Sprachraum Polizei
8.2 Soziolekt Polizei
8.3 Kommunikation der doppelten Teilnahme: Sprache auf der Vorderund der Hinterbühne des Feldes
8.4 Interne Kommunikation
8.5 Externe Kommunikation
8.6 Conclusio
9. Sine ira et studio – Interesse im polizeilichen Feld
9.1. Formalistische Unpersönlichkeit – das Feld zwischen Zerberus und Mutter Teresa
9.2 Nomen Nominandum - Polizeiliches Handeln ohne Ansehen der Person?
9.3 „Sei nie arglos – Rechne immer mit Gefahren!“ - Misstrauen im Feld Polizei
9.4 Militem aut monachum facit desperatio? - Berufswahl Polizei
9.5 Ausgewählte feldspezifische Interessenlagen
9.6 Conclusio
10. Einer von uns – Familiensinn im Feld Polizei
10.1 Tous pour un, un pour tous! - Das Feld Polizei als familiäre Korporation
10.2 Solidarität, Loyalität, Zusammenhalt – Der polizeiliche Ehrenkodex
10.3 Feldspezifische Inauguration - Vereidigung als Setzungsritus
10.4 Goldene Weihen – Die Zwiespältigkeit der verbeamteten Staatsnähe
10.5 Kollegiale Kameradschaft
10.6 Zumutungen der Intimität
10.7 Banalität vs. Großereignis
10.8 Baukasten der Emotionen
10.9 Das Urteil der Kameraden
10.10 Polizeiliche Tugend – der Raum des ethisch und habituell Möglichen
10.11 Conclusio
11. Die Herren von der Kripo und die Männer von der Schutz – Die Logik der Klassen
11.1 Raum von Unterschieden
11.2 Theoretische und wahrscheinliche Klassen
11.3 Conclusio
12. Epilog: Das Feld Polizei – Ein besonderer Fall des Möglichen
12.1 Feldanalyse
12.2 Weiterer Forschungsbedarf
13. LITERATUR
Glossarium